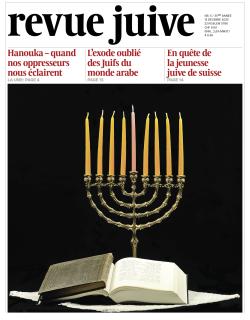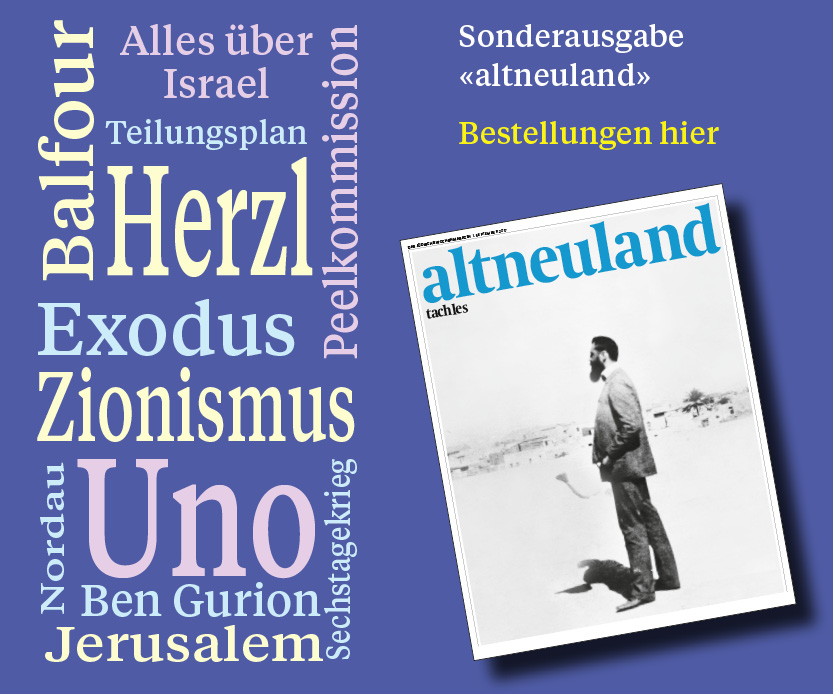Paris, März 2018 – Keiner hat das Violinkonzert von Jean Sibelius so gespielt, wie der Jahrhundertgeiger Ivry Gitlis. Nun sitzt er in seiner Paris Wohnung in St. Germain und rezitiert Zeilen aus seinen Notizen. Er ist 1922 in Haifa geboren, sein Weg führte ihn früh nach Europa zum Studium. Mit seiner Mutter flüchtete er während des Zweiten Weltkriegs nach London, wo er in einem Rüstungsbetrieb arbeitete. Seine Lehrer waren drei hochberühmte Geiger – Carl Flesch, George Enescu und Jacques Thibaud. Er selbst galt als Wunderkind. Aufgetreten und befreundet war und ist er mit den grossen Weggefährten Martha Argerich, Jascha Heifetz, Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Itzchak Perlman. Seine Stradivari steht im Raum. Baujahr 1713. Soeben hat er einen Text geschrieben, der Shakespeare zum Ausgangspunkt und einen Blick auf die immer noch durchgerüttelte Gegenwart nimmt. Ein Text voller Wortspiele und prägnanter Andeutungen zwischen Hoffnung und Ohnmacht angesichts von Kriegen und Verirrungen. «The world is still shaking his pear.» Es folgt ein Gespräch über Musik, Geschichte und die Juden in ihr. Ivry Gitlis hat stets über Musik Kulturen und Menschen verbinden wollen. Humanismus durch Kunst. Bis Gitlis auf die Essenz des letzten Jahrhunderts zurückkommt: «Eines werde ich nie verstehen: Es war nicht der Krieg als solcher. Den gibt es. Es war die industrielle Eliminierung von Menschen, von Juden.» Und spricht weiter: «Du kannst jemanden töten im Affekt, aus Wut, aus Rache. Wir kennen die Geschichten. Doch der bis ins letzte Detail geplante Massenmord hat auch jene dehumanisiert, die nie daran beteiligt waren. So brachial und unbegreiflich ist er.» Gitlis liest weiter aus den Texten, die er tags zuvor geschrieben hat. Darin geht er der Frage nach, wieso Jüdinnen und Juden über Jahrtausende existieren können. Die Sprache bleibt zentrale Antwort. Die eigene Sprache, in der Juden wirkten, lebten, dachten und vor allem schrieben. Das passende Thema vor Pessach und der Frage, was diese jüdische Kultur ausmacht und wie sie sich fortentwickelt. Das Gespräch über eine Kultur des Textes und dasjenige von Heinrich Heines portativem Vaterland. «Heine hat mir diesen Satz geklaut», sagt Gitlis schmunzelnd. Denn für ihn liegt darin die Essenz der jüdischen Geschichte und des jüdischen Überlebens. «Würde Heine noch leben, ich hätte ihn eingeklagt». Gitlis ist aus Überzeugung in Europa, lebt seit 1960 in Paris und betrachtet die Realität mit der Prise schwankender Hoffnung, die so viele jener Generation haben, die im Angesichts des Schreckens überlebt und den Wandel nach dem Krieg erlebt haben. Pessach sieht er geradezu als Prinzip der Befreiung zur Freiheit und der jüdischen Geschichte. Und so passt auch, dass in diesen Tagen das neu erschienene Essay von Hannah Arendt «Die Freiheit, frei zu sein» aus ihrem Nachlass die Feuilletons und Bestsellerlisten anführt. In ihrer spannenden Analyse über Revolution, Freiheit und Tyrannei nimmt Arendt in einem 2017 aufgetauchten und soeben publizierten Essay aus dem Jahre 1966 viele Entwicklungen der Zukunft vorweg und sinniert über Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaft. Gitlis ist diese Ambivalenz und Fragilität nur zu gut bewusst. Die Freiheit der politischen Denkerin spiegelt Gitlis im Zugang durch Kunst, Musse und Liebe. Und liest weiter vom Zwiegespräch zwischen Zukunft und Vergangenheit als Metapher für zwei Liebende: «Ein Tag vergeht und ein anderer bereitet sich vor, um zu kommen. Und Du! Wo bist Du? …»
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
Das jüdische Logbuch
29. Mär 2018
Sibelius, Heine und Arendt
Yves Kugelmann