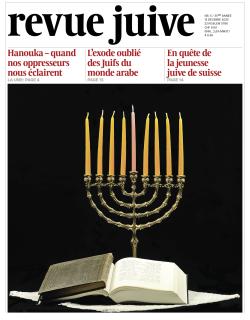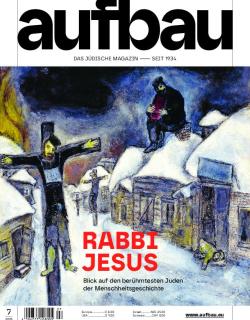Blankensee, August 2025. Deutschland steht wieder einmal Kopf an diesem Freitagmorgen. Längst ist der Gaza-Krieg zu einem Krieg Netanyahus geworden, in den er israelische und jüdische Gemeinschaften inzwischen zunehmend widerwillig hineingezogen hat. Mit seinem Entscheid, dass er für Binyamins Netanyahus geplante Einnahme von Gaza-Stadt die Waffenlieferungen nach Israel stoppen werde, löst der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz tagelange Diskussionen aus. Deutschlands Funktionärsjuden und die Springer-Presse laufen so sehr Sturm, dass sich der israelische Botschafter Ron Prosor zur Causa gar nicht mehr äussern muss. Hat Deutschland den Pfad der Staatsräson verlassen, einen Dammbruch vollzogen oder ein Zeichen gegen eine neue Eskalation der rechtsextremen israelischen Regierung gesetzt, die grosse Mehrheiten von Israelis, Jüdinnen und Juden längst nicht mehr mittragen?
Hamburgs Vorort im Westen: Blankenese. Eine aus der Zeit gefallene Idylle, das fast schon lissabonisch anmutende Treppenviertel – UNESCO-Weltkulturerbe – zeigt die Ambivalenz des Ortes in der 1848 gegründeten und inzwischen benannten Buchhandlung «Wassermann». Der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 markierte den Beginn des Zweiten Weltkriegs. In Blankenese war dieser Tag der Übergang von der NS-Volksgemeinschaft der Jahre 1933–1939 hin zur Kriegsgemeinschaft bis zur Besetzung durch die alliierten Truppen. Die vielen jüdischen Familien wurden vertrieben, gefangen, deportiert – so auch die Bankiersfamilie Warburg. Tausende Zwangsarbeiter – Männer, Frauen, Kinder – mussten in den Elbgemeinden die deutschen Arbeitskräfte ersetzen. Die Familie Warburg spielte eine entscheidende Rolle in Blankenese, sowohl vor als auch nach dem Holocaust. Während der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die «Weisse Villa» am Kösterberg zwangsenteignet, die Familie Warburg musste ins Exil gehen. Während des Krieges nutzten die Nationalsozialisten das Haus als Lazarett.
Das Buch «Kirschblüten auf der Elbe» in der Auslage der lokalen Buchhandlung erzählt die rührende Geschichte von Vertreibung und Rückkehr. Mit Kriegsende kehrte Eric Warburg aus dem Exil zurück. Die Familie stellte das Anwesen ab 1946 humanitär zur Verfügung: Im Kinderheim Blankenese fanden knapp 1000 jüdische Waisenkinder, befreit aus Konzentrationslagern wie Bergen-Belsen, Schutz und neue Hoffnung. Die Finanzierung sowie die Initiative für das Heim stammten massgeblich von den Warburgs, unterstützt von internationalen jüdischen Hilfsorganisationen. Im Herbst 2005 kehren die ehemaligen Waisenkinder für einen gemeinsamen Besuch an den Ort ihrer Kindheit zurück.
Kaum passender ist das Buch von Jakob Wassermann in der Auslage für das Gefühl, das viele Jüdinnen und Juden nicht nur in Deutschland in diesen Tagen der Ungewissheiten umtreibt. «Mein Weg als Deutscher und Jude» ist ein autobiografischer Essay von 1921. Darin beschreibt er die ständige Ausgrenzung, die er als Jude in allen Lebensbereichen erlebte, und schildert, wie ihm selbst wohlmeinende Menschen das Recht auf eine doppelte Identität absprechen wollten: «Ich bin Deutscher, und ich bin Jude, eines so sehr und so völlig wie das andere, keines ist vom anderen zu lösen.» Doch die gesellschaftliche Realität liess das nicht zu – Juden wurden trotz aller Assimilation immer als fremd betrachtet. Er zeigt, wie tief der Antisemitismus bereits vor dem Nationalsozialismus im deutschen Alltag verwurzelt war. Hundert Jahre später, in anderem Kontext, zeigt der Essay eine Gefühlslage, die viele deutsche Juden wieder ähnlich verorten und mit einem Bein auf dem Absprung sind, während andere Jüdinnen und Juden in den USA und England weiterhin hoffen, einen deutschen Pass zu erhalten.
Längst ist es heiss geworden in Blankenese. Die Elbe ist geflutet. Aus der Ferne klingen die Motorgeräusche der immensen Containerschiffe, deren Motoren bis ins Treppenviertel zu hören und teils zu spüren sind. Die Menschen sitzen in den Cafés, lesen Bücher und Zeitungen – wie einst. Während auf den Mobiltelefonen eine Eilnachricht die andere jagt, scheint in der Buchhandlung «Wassermann» der Blick zurück auch ein Blick nach vorn zu sein, etwa in dem erstmals im Buch «Über Palästina» auf Deutsch erschienen Texten von Hannah Arendt: «American Foreign Policy and Palestine» von 1944 und «Das palästinensische Flüchtlingsproblem» von 1958.
Gemeinsam mit anderen Forschern präsentiert Arendt für das Institute for Mediterranean Affairs eine scharfe Analyse und Lösungen für das palästinensische Flüchtlingsproblem nach 1948 und fordert eine «Normalisierung» des Lebens der Geflüchteten. Ein Ansatz ist dabei die Rückkehr der Vertriebenen an ihre Herkunftsorte oder eine Repatriierung, während aber gleichzeitig auch die existenziellen und sicherheitspolitischen Bedürfnisse Israels, einschliesslich der jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern, betont werden. 70 Jahre später liest sich die Analyse mit vielen Faktenanhängen zu UNRWA, den Zahlen von Einwohnern und Vertriebenen, den Kriegshandlungen, dem politischen Versagen aller Seiten nochmals ganz aktuell und ganz anders. Denn die damals greifbaren Lösungen sind heute kaum mehr vorstellbar; der Zugang von Arendt, die den Text aus eigener Flüchtlingsperspektive denkt, erscheint geradezu utopisch, etwa wenn sie schreibt:
«Der arabisch-jüdische Konflikt kann und wird sich lösen lassen innerhalb des Rahmens einer freundschaftlichen Kooperation aller Mittelmeervölker, die um ihrer politischen Unabhängigkeit und freien ökonomischen Entwicklung willen ohnehin auf gute nachbarschaftliche Verhältnisse und vielleicht sogar auf eine Föderation angewiesen sein werden.»
An die 1752 gebaute und längst zerstörte Synagoge erinnert ein Stolperstein, wie so viele andere, während in der jüdischen Gemeinschaft die Debatte über den Gaza-Krieg immer mehr spaltet. Ist dieser Krieg Israels einer des jüdischen Staates, wird in Gaza die jüdische Freiheit verteidigt – oder eher weltweit riskiert? Soll die jüdische Gemeinschaft reflexartig in Krisen- und Kriegszeiten die Doktrin des jeweiligen israelischen Regimes willentlich oder widerwillig mittragen? Oder wollen viele Jüdinnen und Juden – wie andere argumentieren – nicht sehen, dass die Gemeinschaft wieder in einem blinden 30er-Jahre-Modus verharrt und Antisemitismus wieder vernichtend sein wird? Betreiben die Medien eine antiisraelische Kampagne oder bilden sie einfach eine asymmetrische Situation eines Krieges ab, den bis vor kurzem auch die Staatengemeinschaften noch mitgetragen haben? Die nicht geführte Debatte spaltet täglich innerhalb der jüdischen Gemeinschaft.
Arendt schreibt 1944: «Selbst im Falle eines Kriegsgewinns wäre die Gründung eines jüdischen Staats inmitten einer feindlichen arabisch-palästinensischen Mehrheit zum Scheitern verurteilt. Das jüdische Volk würde zu einem Kriegerstamm werden.» Die Juden ein Kriegsstamm – oder dann doch eher die israelischen Nationalisten, oder ist das mittlerweile eins? Der jüdische Plan war ein anderer und Israel ein Teil darin. Doch mittlerweile konzentriert sich alles auf Israel – und wird zur Judenfrage. Bei Arendt kumuliert das im Kontrast zur Realität von heute: «Die Existenz der Juden in Palästina hängt davon ab, dass eine jüdisch-arabische Freundschaft errungen wird.» Da schwingen die Texte von Theodor Herzl, Martin Buber, Gershom Scholem mit. Im deutschen Blankenese liest sich all dies an diesem ambivalenten, vielleicht schicksalhaften Freitag nochmals anders – zwischen verklärter Vergangenheit und ungeklärter Gegenwart. Wer jetzt schon an die Tage nach dem Krieg, gar an Aus- und Versöhnung denkt, fällt für viele aus der Zeit. Doch die Kirschblüten auf dem Tisch erinnern nicht an eine Träumerei, sondern eine wartende Zukunft: Irgendwann wird es vor allem darum gehen, wie Menschen in der so gebeutelten Region wieder zusammenleben können.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
15. Aug 2025
Kirschblüten aus fernen Jetztzeiten
Yves Kugelmann