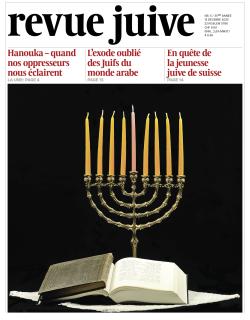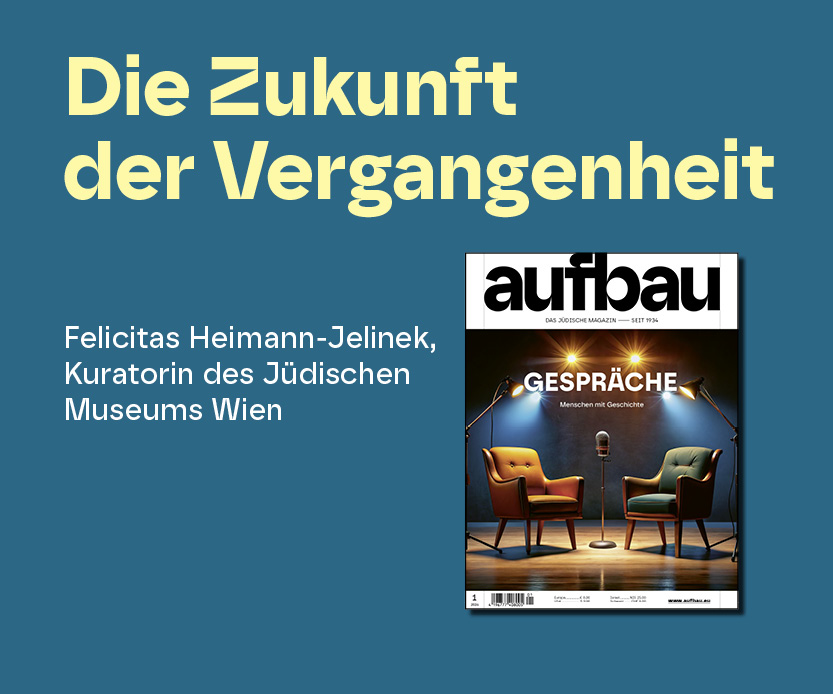Venedig, September 2018. Es ist Elul. Zum 75. Mal findet in diesen Tagen das 1933 gegründete Filmfestival in Venedig am Lido statt. Es steht für die wechselvolle Geschichte der Stadt unter dem Faschismus, dem Aufbruch zur Avantgarde ab den 1950er-Jahren und für die Neuerfindung des schliesslich als morbid und veraltet verschrieenen Festivals. Mit einem engagierten Programm schafft die Filmbiennale auf subtile und kreative Weise die Reflexion aktueller Entwicklungen in allen Teilen der Welt. Von den politischen Umwälzungen der Gegenwart, den Herausforderungen des Klimawandels und schlicht mit einem Feuerwerk an Ideen und einem Hang zur Nostalgie. In diesem Jahr mit einer Fotoausstellung im provisorisch wieder eröffneten legendären Hotel «Des Bains», wo Regisseur Luchino Visconti Thomas Manns «Tod in Venedig» verfilmte. Vor dem Hotel laufen Menschen stundenlang die Sandstrände auf und ab. Es ist einiger der wenigen Ort, wo dieser Gang auf und ab zum Ritual des Gesprächs wird. Menschen, Paare, grosse Familien, viele ältere Menschen, oft in Gruppen, laufen kilometerweit auf und ab – zum Gespräch. Gemächlich, ungestört, beruhigend.
Elul. Der Monat der Einkehr im Hinblick auf die hohen jüdischen Feiertage ist vielleicht der Monat des Gesprächs. Der Name Elul erinnert ans babylonische Exil vor rund 2500 Jahren und somit an die jüdische Völkerwanderung durch Geschichte und Orte, an die guten und schlimmen Zeiten in der jüdischen Migrationsgeschichte zwischen Sesshaftsein und Vertriebenwerden. Elul ist die Verortung des Individuums in der Gesellschaft, seiner Geschichte und sich selbst. Venedig steht symptomatisch für diesen jüdischen Teil der Geschichte: Migration, Manifestieren der eigenen so ausgeprägten jüdischen Kultur entlang jener des Ortes selbst und den Versuch, diese in die Zukunft zu tragen. Durch die Menschen vor Ort und vom Ort. Durch Authentizität und gewachsene Kultur.
Ihre Familie emigrierte vor rund 250 Jahren von der heute griechischen Insel Korfu nach Venedig. Dort arbeitet Annamarina im jüdischen Ghetto in einem der ältesten Geschäfte. Dort ist sie aufgewachsen. Sie hat den markanten Wandel der geschichtssträchtigen Stadt hautnah erlebt. Heute lebt sie in Mestre, der kleinen Stand auf dem Festland auf dem Weg in die Lagunenstadt. Annamarina ist über 70 Jahre alt. Täglich arbeitet sie im Ghetto, am Schabbat besucht sie die Synagoge. Unser Blick ist auf die beiden alten Synagogen gerichtet, wir sind umringt von drängenden Touristen, und in der kleinen Ghettostrasse zeigt sie auf die levantinische Synagoge und wendet sich ab von jener von Chabad. «Wir gehen dort hin.» Sie sagt dies nicht mit Stolz, aber einer Prise Trauer in der Stimme. Annamarina trägt viele Jahrhunderte Familiengeschichte in sich, die sie gegen den von aussen herangebrachten Jugendkitsch zu bewahren versucht. Und so stehen wir an diesem Spätnachmittag und sprechen noch lange über Traditionen und Geschichten, die sich in keinem Buch finden, in diesem Ghetto im Ghetto. Im Elulgespräch. Und dann sagt sie: «Leben kann ich hier nicht mehr. Doch ich muss jeden Tag hierher zurückkommen.»
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
Das jüdische Logbuch
07. Sep 2018
Selbstgespräch mit der Wirklichkeit
Yves Kugelmann