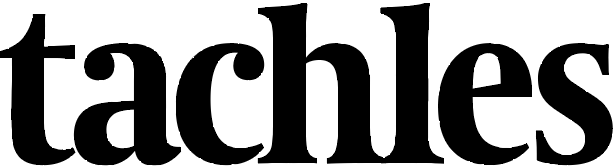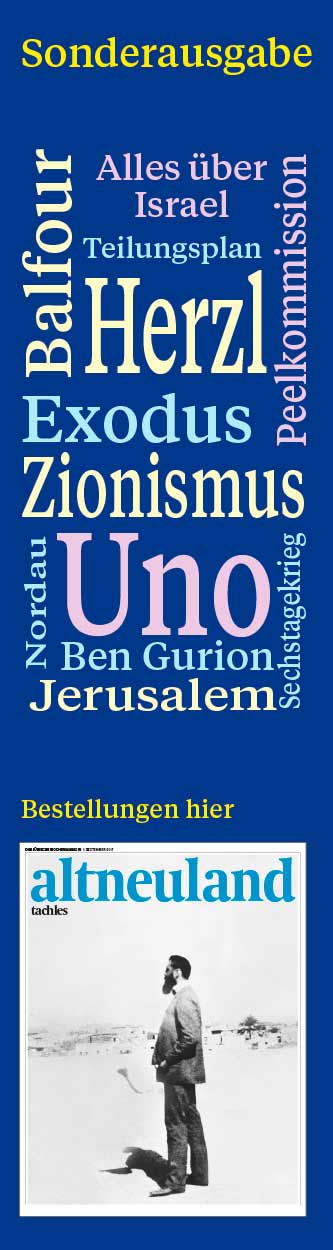Berlin, Juni 2022. Der längste Tag, die kürzeste Nacht. Mitten in Berlin Friedrichshain singt das Semer Ensemble jiddisch, deutsch, russisch, hebräisch Lieder aus der goldenen Zeit jüdischer Musik im immer dunkler werdenden Berlin der 1930er Jahre. Lieder voller Freude, Trauer, Liebe, Witz, Eifersucht, Lieder über Tagtägliches und eben in jedem Satz über das Politische. Ein Live-Konzert für einen Kinofilm über das jüdische Plattenlabel Semer, das Hirsch Lewin 1932 gründete. Das Publikum ist euphorisch, die Musikerinnen und Musiker zelebrieren authentisch jüdische Musik abseits von Klezmer-Kitsch, Folklore-Fake und Verfremdung. Das ist echt, das wird immer echter. Auf der Bühne vermischen sich Sprachen, Kulturen, Traditionen zu einem musikalischen und immer wieder nostalgischen Feuerwerk. Denn alle wissen, dass diese goldenen Jahre keine und bald vorbei waren. Mit jedem Lied schwingt die Nachgeschichte und die Tatsache mit, dass diese Musikerinnen und Musiker mit viel Recherche eine Tradition wiederentdeckt haben, die vernichtet worden war. Die Sängerin Sasha Lurje ist in Riga geboren, Teile der Familie kommen aus Russland. Es wird der emotionale Moment des Abends, als sie ein russisches ansagt – und eben die neue Gegenwart die Schatten der 1930er spiegelt. Jedes Lied, jeder Satz, jede Strophe bekommt in diesen Wochen eine Bedeutung. Die russischen, die jiddischen Lieder verbinden sich zu einem Plädoyer gegen Krieg und Faschismus, die Lieder voller Euphorie, Hoffnung, Utopie. Die Texte zu «Kaddisch», «Scholom Baith» oder ein Wiegenlied transformieren die Vergangenheit in eine reale Gegenwart mit neuen Vorzeichen. Die «Mutter liegt im Grabe, mit Scherben auf den Augen». Sie wird nicht wiederkommen, «oh, wer wird mein Kind ankleiden, wer wird meinem Kind die Haare kämmen»? Das Liebeslied «Vorbei» spricht vom letzten Gruss, vom letzten Brief, vom letzten Wort – vom Abschied auf immer, und immer klingt der Widerstand mit. Ein Berliner Abend in absurden Zeiten mitten im erneuten Debatten-Gewitter um ein Gemälde mit antijüdischen Motiven an der neu eröffneten Documenta in Kassel (vgl. Standpunkt von Gabriel Heim). Ein Debatten-Gewitter, das eigentlich gar keines ist – um dann in die deutsche Dramaturgie von Eskalation, Reflexen, Empörung, Verteidigung, schliesslich grossem Mea Culpa zu münden. Das einzige intelligente Votum kam vom deutsch-israelischen Soziologen Nathan Sznaider: Er sprach sich gegen den Abbau des Gemäldes aus, damit die Künstlergruppe Taring Padi und letztlich die Gesellschaft sich einer Diskussion über Antisemitismus stellen kann. In einem Essay in der «Zeit» von gestern Donnerstag kommt er zum Schluss: «Die Frage, ob die Kunst nun antisemitisch oder antiisraelisch ist, spielt dabei eine untergeordnete Rolle.» Denn es gehe um mehr. Und dieses Mehr kann nicht in Sanktionen, in einem absurden Cancel-Primat ertränkt, sondern muss offen, frei debattiert werden. Die richtige, offene Debatte ist schmerzhaft, doch sie entlarvt und demaskiert im Gegensatz zum Tango der Rituale bei solchen Diskussionen die Büttenredner aller Fraktionen. Die Debatte ist bald wieder vorbei, der Antisemitismus bleibt – doch die Lieder Hoffnung werden beide überragen: «Oy, gotenyu, mayn harts baglikn, Makh a sof fin zayn farbisn, Gotenyu liber, gotenyu giter, Shuloym zol shoyn zayn!» (Ach Gott, mach mein Herz glücklich / Mach dieser Bitterkeit ein Ende / Lieber Gott, guter Gott / Lass endlich Frieden sein!).
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
24. Jun 2022
Russische Lieder gegen den Krieg
Yves Kugelmann