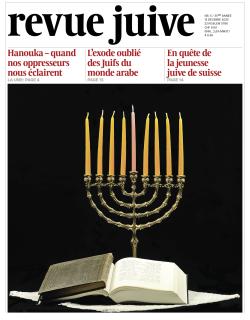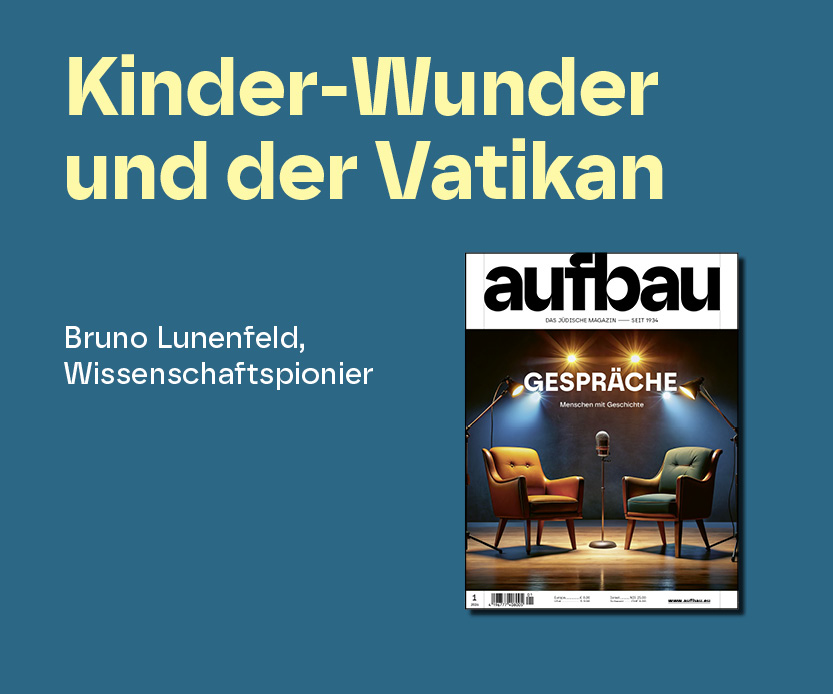Berlin, Februar 2025. Klirrende Kälte und Schnee. Debatten an der, um und über die Berlinale. Dann prasseln die Nachrichten über die US-Ansage zur Europapolitik herein, später in der Regierungshauptstadt jene über die Russland-Verhandlungen. Vor den Wahlen spürt man die nüchterne Anspannung im Angesicht der Ahnung, dass da herausfordernde Jahre anstehen. Im Kulturkaufhaus an der Friedrichstrasse findet sich ein Raum für Reflexion. Die Buchhandlung hat bis Mitternacht geöffnet. Auch an diesem Abend ist sie gut besucht. Die einen flüchten vor der Kälte, die anderen geniessen die Abendstunden, um in Büchern zu schmökern oder sich von den wohl kuratierten Büchertischen inspirieren zu lassen. Es ist die geistige Gegenwelt zur Realität mit einem Fundus an Literatur, auf der die offene Gesellschaft gründet und vielen Büchern, die die Gegenwart spiegelt.
Auf einem dieser Tische stechen die Notizen eines Philologen hervor. Victor Klemperer schrieb «LTI» im Jahre 1947. Darin analysiert er die Sprache des Nationalsozialismus. Das Kürzel steht für Lingua Tertii Imperii, also die Sprache des «Dritten Reiches». Er zeigt, wie nationalsozialistische (NS) Propaganda die deutsche Sprache durch neue Begriffe, Redewendungen und ideologische Manipulation veränderte. Und damit die deutsche Realität. Klemperer beschreibt, wie diese Sprache nicht nur die öffentliche Meinung beeinflusst, sondern auch das Denken der Menschen prägt. Er dokumentiert sprachliche Veränderungen während der NS-Zeit und wertet sie nach dem Krieg aus.
Das Werk ist faszinierend und erschreckend aktuell, wenn man sich den neuen Populismus, Faschismus, Autoritarismus und die allgegenwärtige Verführung durch Sprache in Erinnerung ruft.
«Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da» schreibt Klemperer.
Ernst Cassirers «Mythos des Staates» (1946), Hannah Arendts «Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft» (1951), Ludwig Wittgensteins «Philosophische Untersuchungen» (1953), Elias Canettis «Masse und Macht» (1960) – so viele Grundlagenwerke über das Verhältnis von Sprache, Macht und Verbrechen sind in jenen Jahren entstanden. Ihnen folgte Literatur wie Heinrich Manns «Der Untertan» oder George Orwells «1984», in dem er schreibt: «Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.» Orwell seziert, wie totalitäre Systeme durch Kontrolle der Sprache und der Geschichtsschreibung das Denken der Menschen beeinflussen. Heute manipulieren Algorithmen, Populisten und Autokraten aller Couleur die Sprache, und die Frage bleibt: Bemerken es Menschen oder nicht? Lassen sie die Manipulation zu oder wehren sie sich? Denn das Morden beginnt mit Worten – die Sprache kontaminiert die Zukunft im Guten, wie im Schlechten.
Die Buchhandlung führt Menschen aus aller Welt zusammen. Dort ein israelisches Pärchen auf der Suche nach einem Theaterstück in der englischen Sektion, hier eine ukrainische Studentin, die die Wissenschaftsabteilung durchstöbert, und in der Ecke sitzt eine junge Mutter mit dem Baby im Kinderwagen und liest ein Buch. Bei der Literatur liegt ein Gedichtband von Selma Meerbaum-Eisinger. Ihre im Konzentrationslager geschriebenen Liebesgedichte haben auf abenteuerliche Weise den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und gehören zu den schönsten Texten jener Zeit. Sie sind das Gegenteil von Sprache als Gewalt- und Machtinstrument: zarte, lebensbejahende, hoffnungsvolle Texte – eine Sprache der Freiheit, wider die des Barbarismus. Hier in Berlin ist er irgendwann eskaliert, trotz der Poppers, der Arendts, der Kafkas, der Lasker-Schülers, der Manns, der Kästners. In seinen Tagebüchern wird Victor Klemperer später notierten: «Berlin war die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten – im Guten wie im Bösen.»
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
21. Feb 2025
Endstation Realität
Yves Kugelmann