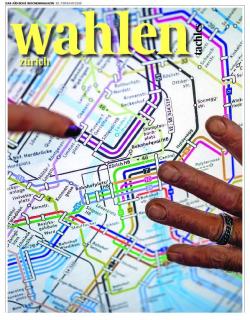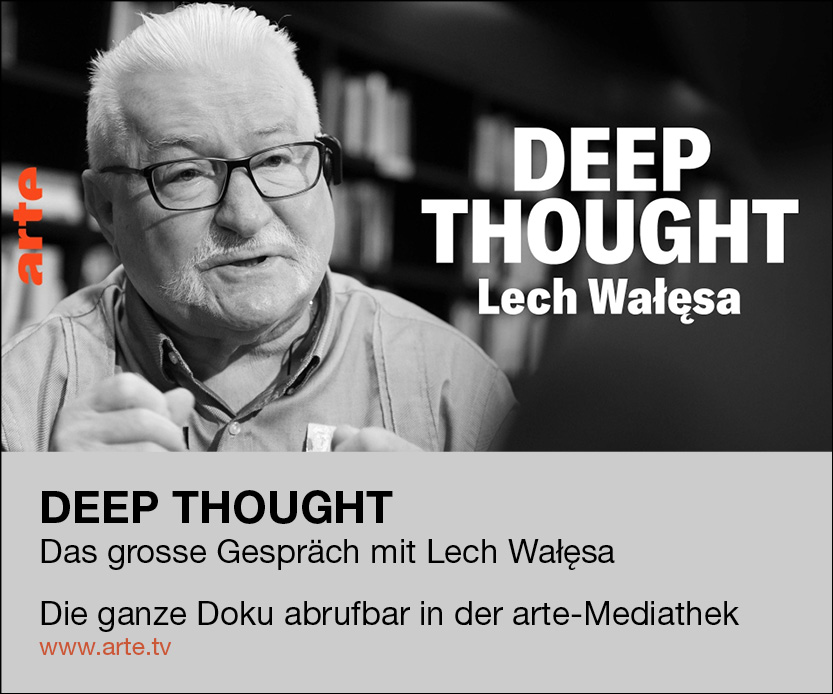Zürich, November 2025. Die Unklarheit darüber, was letztlich Antisemitismus ist, wird nicht kleiner, sondern mit der Ausweitung der Definitionen grösser. Das mag im politischen Interesse der einen oder anderen Fraktionen sein, aber vielleicht nicht der Sache. Denn Antisemitismus, also Judenhass, sollte vor allem auch für jene Klarheit bringen, die mit dem Vorwurf konfrontiert werden. War der Antisemitismus-Vorwurf früher wirksam, hat er seine Schlagkraft längst verloren. Er ist zu diffus, zu inflationär und instrumentalisiert geworden. Was das für all jene heisst, die Antisemitismus mit hoher Integrität ahnden, oder für jene, die ihn zum Geschäftsmodell gemacht haben, ist eine andere Diskussion, die es zu führen gilt.
Für Theodor W. Adorno ist er «das Gerücht über die Juden»: keine Reaktion auf reale Jüdinnen und Juden, sondern ein sich verselbständigender Mythos, der gesellschaftliche Konflikte personalisiert und auf eine Fantasiefigur «des Juden» projiziert. Dieses Gerücht funktioniert wie ein Geruch: diffus, schwer zu greifen, kaum zu beseitigen – und doch allgegenwärtig im gesellschaftlichen Klima. In der Moderne werden abstrakte Erfahrungen von Ohnmacht, Konkurrenz und Krisen so auf «die Juden» verschoben, dass aus strukturellen Problemen scheinbar ein «Judenproblem» wird. Antisemitische Verschwörungsnarrative – paradigmatisch die «Protokolle der Weisen von Zion» – verdichten das Gerücht zur geschlossenen Erzählung einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung.
Aufklärung im engen Sinne, also blosse Information über jüdisches Leben, reicht daher nach Adorno nicht aus, weil das Ressentiment nicht an Fakten, sondern an unbewusste Wünsche, Ängste und Aggressionen gebunden ist. Bekämpfung des Antisemitismus heisst für ihn, diese psychischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Gerüchts offenzulegen – und ein Denken zu fördern, das auf Projektionen verzichtet und die eigenen Verstrickungen in Herrschaft reflektiert.
Die Dramatik des digitalen Zeitalters zeigt sich im Judenhass in neuer Dimension und daran, wie wenig Aufklärungsarbeit bewirken konnte. Dass innerhalb der jüdischen Gemeinschaften Juden stigmatisiert, ausgegrenzt, mit Judenhassvorwürfen an den Rand gedrängt werden, ist nicht neu, aber im Kontext der Entwicklungen Israels der letzten Jahrzehnte massiver geworden.
Ob es gut ist, dass Israel in Debatten um ESC, FIFA, Waffenlieferungen in die Ukraine und so fort an oberster Stelle verhandelt werden muss und gleichsam eine Stigmatisierung noch befördert – gerade dort, wo Kausalitäten nicht gegeben sind –, ist das eine. Ob aber der Nahe Osten bis in die Mikropolitik jüdischer Organisationen, Gemeinden und weltweit der Spalttiegel sein muss, der er geworden ist, müssen die jüdischen Gemeinschaften unter sich und mit Israel im Nachgang zum letzten Krieg ernsthaft verhandeln. Jüdische Einheit kann nicht das Ziel diverser, offener, demokratischer Gesellschaften sein - aber Fairness, ein Minimum an Kompetenz und Redlichkeit im Umgang mit Antisemitismus oder eben Vorwürfen von Selbsthass, Nestbeschmutzung. Nicht nur, weil gerade Antisemitismuslobbyisten zu oft auf einen Pakt mit falschen und vermeintlichen Freunden zurückgehen, die einer wichtigen Sache schaden. Der Sisyphos-Kampf gegen Judenhass ist auch so gross genug.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
28. Nov 2025
Das Gerücht über Juden von Juden
Yves Kugelmann