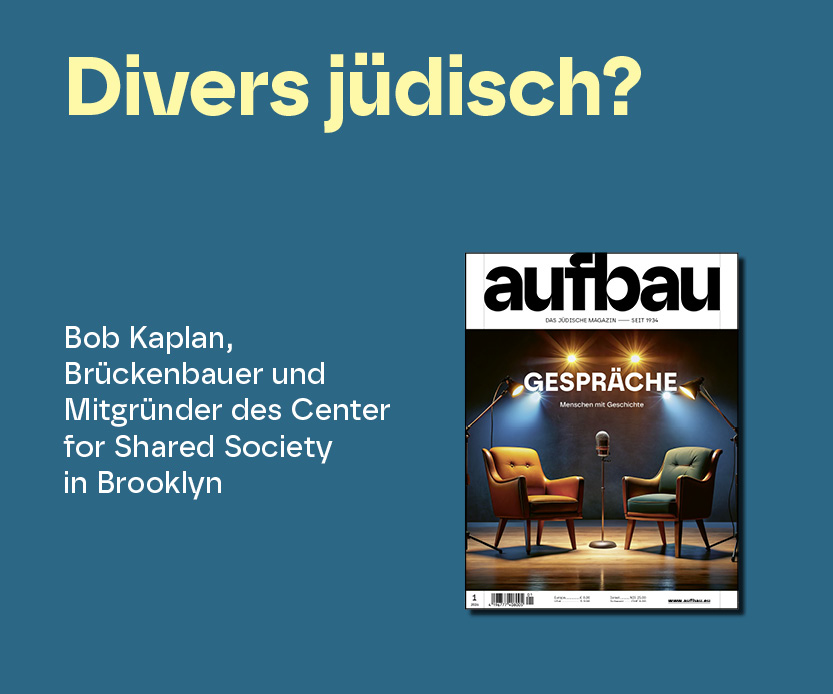München, November 2025. Alles ist gut. Längst haben sich so viele mit so vielem abgefunden – sei es aus alten und neuen Überzeugungen, aus Lethargie oder als Zuschauende. Die neue Normalität hat sich widerstandslos eingeschlichen. Menschen, die nie von Krieg und Gewalt gesprochen haben, führen heute Kriegsrhetorik im Mund. Die Sprache, die Positionen, das Reden über andere hat sich gewandelt. Woher kommt das?
Es ist Winter geworden. In München weht ein beissender, kalter Wind über die Strassen. An einer Hotelrezeption beim Theater kurz vor Mitternacht erzählt der Nachtportier einem Künstler Geschichten aus dem Münchner Wald. Ein kleiner, buckliger Herr mit wachen Augen spricht in perfektem Deutsch mit ungarischem Akzent und viel Humor. Er emigrierte 1985 mit 53 Jahren aus Budapest – ein Original, wie aus dem Film.
Inzwischen über 80 Jahre alt, blickt er unaufgeregt auf eine aufgeregte, gestresste Welt. Im NS-Dokumentationszentrum strömen Schulklassen durch die Ausstellung. Die Schülerinnen und Schüler werden konfrontiert mit den Mechanismen von Propaganda, Stigmatisierung und «alternativen Fakten», die auf den Holocaust hingeführt haben. Am Abend wird die Stadträtin der Landeshauptstadt München, Mona Fuchs, bei einer Ansprache die Frage in den Raum werfen, ob man historische Vergleiche anführen solle, und beantwortet dies gleich mit einem erfrischenden Ja. Gleichsetzen allerdings sollte man Geschichte keinesfalls. Und natürlich trifft sie damit in aktuelle Debatten, die sie an diesem Abend nicht gemeint hat – aber eine jüdische Gemeinschaft zu lange ebenso nicht beschäftigt hat, wie viele sich nicht mit Ausgrenzung von Juden oder der vom Gaza-Krieg losgelösten Situation nach dem 7. Oktober 2023 auseinandergesetzt haben.
Soll zu Siedlergewalt in der Westbank geschwiegen werden? Kann alles wegrationalisiert und immer nur ins Feld geführt werden, dass so vieles andere so viel schlimmer wäre – der Genozid im Sudan etc. ja auch niemand interessiere. Auf der Treppe sitzt ein jüdischer Mann um die 50. Er ist vor 20 Jahren aus den USA nach Deutschland gekommen. Er hadert. «Seit zwei Jahren bin ich nur noch traurig.» Der Gaza-Krieg hat ihn ebenso verstört wie die Reaktion vieler seiner Freunde auf die Massaker der Hamas. Das verbreitete Schweigen in der jüdischen Gemeinschaft zur rechtsextremen israelischen Regierung mit faschistoiden Vertreibungsvisionen, die Ignoranz gegenüber Antisemitismus bei Antiisraelprotesten, die Infiltration von Propaganda allenthalben – all das verstört ihn. Und dass kaum mehr Reflexe dagegen bestehen.
Er erzählt von einem anderen Judentum in den USA, das so viel weiter, so viel politisch liberaler sei, und von jenen Gemeindejuden, die hier in Europa längst einen Pakt mit Rechtspopulisten und deren Rhetorik eingegangen sind. «Ich bin traurig», wiederholt er mehrfach. «Ich erhebe meine Stimme weiterhin, arbeite an zivilgesellschaftlichen Projekten für Dialog.»
Er wird noch lange erzählen von den inneren Zerissenheiten, von Aufrichtigkeit wider duckmäuserische Tendenz aus falscher Angst vor irgendwas. – Ist wirklich alles so schlimm? Sind die Ängste von so vielen Jüdinnen und Juden – gerade in Gemeinden – mehr als Ausdruck emotionaler Befindlichkeiten? Welche Realitäten haben sich wie verändert, und welche sind herbeigeredet?
Die Schülerinnen und Schüler scheren sich wenig um das Diktum von Gleichsetzung und Vergleich. Ideologien spielen keine Rolle. Sie diskutieren in der Eingangshalle des Dokumentationszentrums über Gewalt gegen Juden, über die Führung durch die Ausstellung und über den Nahostkonflikt. Es ist eine befreite Diskussion – und natürlich herausfordernd in alle Richtungen. Aber wichtig.
Und dann die Frage: Könnte all dies anständig, ohne Drohungen, ohne Sanktionen offen bei einer Veranstaltung in einer jüdischen Gemeinde, auf dem Panel an einer Universität oder sogar in den Spalten einer jüdischen Zeitung verhandelt werden?
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
21. Nov 2025
Der Nachtportier vom Theaterwald
Yves Kugelmann