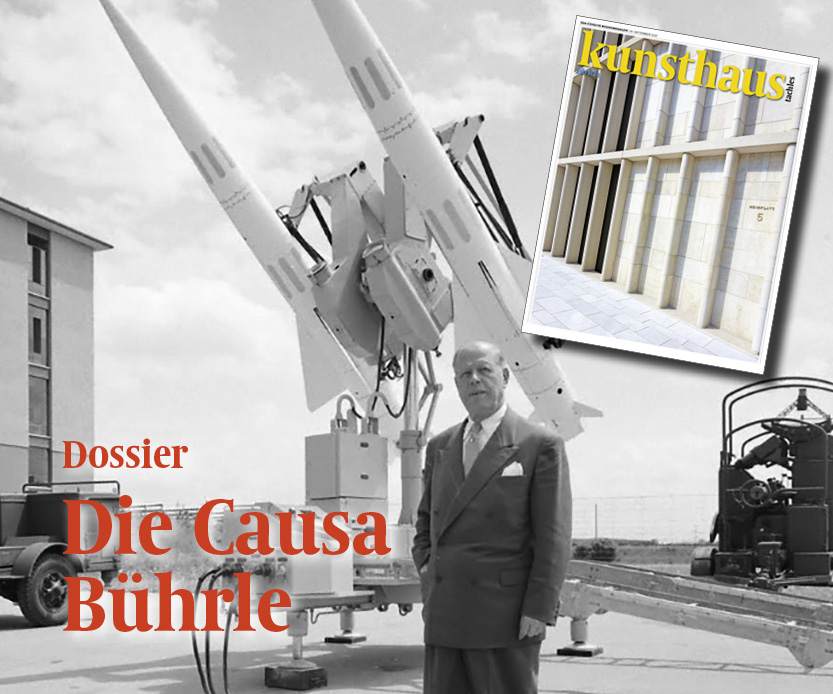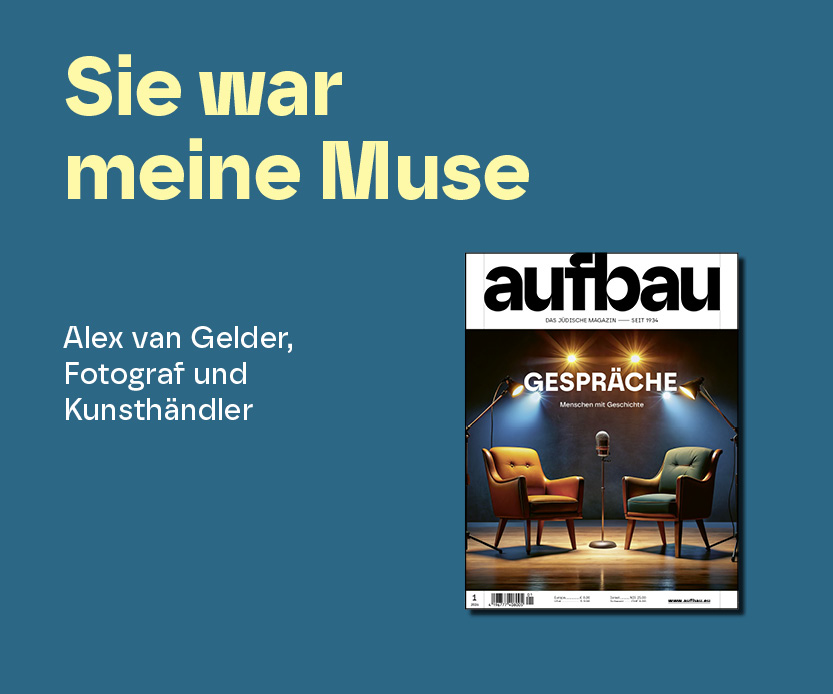Biberach, November 2025. Biberach ist eine behagliche kleine Stadt unweit von Ulm. Einst bildeten die baden-württembergischen Gemeinden mit Laupheim, Hechingen, Bahlingen ein Zentrum jüdischen Lebens und Schaffens – bis zur Vertreibung und Ermordung der Juden durch die Nazis. Das Foto in der kleinen Kabinettsausstellung im Kino der Baden-Württemberger zeigt zwei Männer, die emigrieren mussten, im amerikanischen Exil – und erzählt Bände. Es zeigt Carl Laemmle und Albert Einstein im Jahr 1931 in Los Angeles im Exil. Das Bild dokumentiert die Begegnung des Universal-Pictures-Gründers und des Physik-Genies während Einsteins Besuch in den Universal Studios. Vielleicht wären sie sich in Deutschland in Ulm oder Laupheim nie begegnet. Carl Laemmle, 1884 in Laupheim geboren, verliess als junger Jude Deutschland, um in den USA sein Glück zu versuchen, und wurde dort Filmtycoon und Gründer von Universal Pictures. Zunächst vermied er politische Konflikte, doch die Premiere von «Im Westen nichts Neues» im Jahr 1930, an der auch Albert Einstein teilnahm, der den Film begeistert lobte, wurde in Deutschland nach dem Oscar-Erfolg von den Nazis gewalttätig gestört und bald verboten – jüdische Namen wurden bei der deutschen Premiere entfernt. Laemmle erkannte bei einem Besuch in Deutschland die dramatische Lage der jüdischen Familien und engagierte sich zeitlebens für deren Rettung. So auch für die Emigration von Einsteins Vater Hermann. Nach seiner Entmachtung durch eine feindliche Übernahme bei Universal widmete er all seine Ressourcen dem Schutz jüdischer Flüchtlinge: Mit Hilfe kluger Netzwerke rettete er mehr als 300 jüdische Familien, darunter viele Wissenschaftler und Intellektuelle, oft gegen grossen bürokratischen Widerstand – ein Einsatz, der Jahrzehnte lang vergessen blieb.
Der Rest ist Geschichte. Laemmle avancierte zu den prägenden Gründervätern Hollywoods: Er baute mit Universal City das erste grosse Filmstudio, etablierte das Star-System und machte Hollywood zur weltberühmten Traumfabrik. Mit über 400 produzierten Filmen, darunter Klassiker wie «Dracula» und «Frankenstein», schuf er die Grundlage für die amerikanische Filmindustrie und setzte Standards, während Albert Einstein die Naturwissenschaften des 20. Jahrhunderts mit seiner Relativitätstheorie wie kaum ein anderer prägte und zum ersten Public Intellectual des 20. Jahrhunderts avancierte – und aktuell nochmals gelesen werden sollte, angesichts seines Engagements für den Weltfrieden und seines Schicksals als geistiger Vater der Atombombe. Was wäre geschehen, wenn Einstein, Laemmle und so viele andere in Deutschland geblieben wären?
Im beschaulichen Biberach findet man nicht viel, das an die jüdische Geschichte erinnert. Kein Stolperstein, auf der Schule bei der Polizeiwache das Mahnmal «Der Schrei». Die jüdische Geschichte in Biberach reicht bis ins Mittelalter zurück, als die Stadt eigenen Judenschutz genoss und jüdische Finanziers eine wichtige Rolle für das Wirtschaftsleben spielten. Nach schweren Verfolgungen und Ausweisungen endete die jüdische Tradition im 16. Jahrhundert; einzelne jüdische Familien waren aber bis ins 20. Jahrhundert ansässig. In der Zeit des Nationalsozialismus lebten nur noch wenige Juden in Biberach, einige wurden in Konzentrationslager deportiert oder starben in lokalen Lagern wie dem Lager Lindele. Nach 1945 entstand im Jordanbad kurzzeitig ein jüdisches DP-Camp mit etwa 400 Überlebenden des Holocaust, die sich auf die Auswanderung nach Israel vorbereiteten. Hätten nicht ein paar sehr engagierte Menschen, wie der vor drei Jahren verstorbene Laupheimer Karl-Hermann Blickle, über Jahre Engagement gezeigt, wäre die jüdische Geschichte der Region noch vergessener – und mit Carl Laemmle gesagt: «It can be done!»
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
07. Nov 2025
Die Erfindung Amerikas
Yves Kugelmann