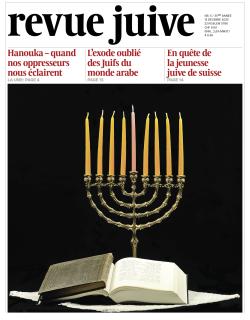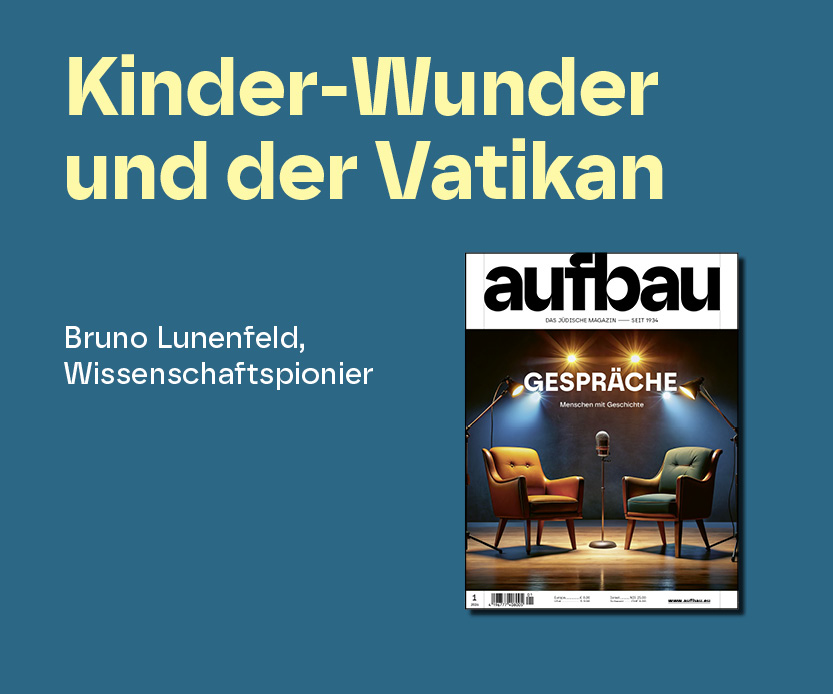Jerusalem, Oktober 2025. Die Fahnen hängen überall. Im Zweigespann säumen Blau-Weiss und Blau-Weiss-Rot die Strassen nach und durch Jerusalem. Die grosse Trump-Show ist vorüber, die Geiseln endlich zurück, die Ernüchterung hat längst die grosse Euphorie verdrängt. Am Nachmittag sitzen Anwalt und Bruder einer vor zwei Wochen freigelassenen Geisel in einem prächtigen alten Garten Jerusalems. Es ist sommerlich, der Himmel strahlt blau. Sie erzählen akribisch von den zwei Jahren der Haft. Zwei Jahre in einem Tunnel mit anderen Geiseln. Kein Tageslicht, kein Ortswechsel. Details über Alltag, über Gespräche, Kontakte mit den Hamas-Schergen, über die Gewalt, das asymmetrische Spiel, wie sie es nennen werden. Geben und Nehmen, Psychoterror und so fort. Sie erzählen zwei Stunden lang. Dann von den Tagen vor, während und nach der Befreiung. Von einer israelischen Regierung, die sie zu oft im Stich gelassen hat, die sie noch mehr ablehnen als vor dem Schicksalstag, dem 7. Oktober 2023. Eine Chronik, die sich in den Erzählungen weiterer Gespräche anders und doch immer wieder gleich zeigen wird. Es ist die ruhige Schabbatstille Jerusalems, in die die Gespräche zurückhallen. Voller Nüchternheit. Fast schon emotionslos, selbstgewiss und keineswegs gebrochen.
In der German Colony gibt der Basler Emanuel Cohn einen Schiur in einer Synagoge an der Hildesheimer Strasse über den Wochenabschnitt anhand der strukturalen Linguistik nach Roman Jakobson. Eine faszinierende Stunde europäischer Gelehrsamkeit aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts, in die Moderne übersetzt. Eine Gelehrsamkeit, die Jerusalem in diesen Strassen so prägte und für die auch Esriel Hildesheimer aus Halberstadt steht. Er gilt neben Samson Raphael Hirsch als Begründer der Neoorthodoxie. Talmud Thora im Derech Eretz sollte einen Weg des Lernens weisen, in dem das Weltliche integriert, aber kein Kompromiss am Judentum gemacht wird. Cohn – auch tachles-Kolumnist (s. oben) – reflektiert in dieser Tradition auf der Basis moderner Wissenschaft jüdische Fragen. Als Urenkel des Berliners Arthur Cohn und Begründer des Jüdischen Lehrhauses Schomre Thora in Basel ist er mit diesem Judentum sozialisiert worden. Ein Judentum, an das die Strassen in der German Colony allenthalben erinnern und das es kaum mehr gibt. Ein Judentum des offenen, zukunftsgewandten Denkens auf Basis einer immer neu übersetzten Tradition, das sich in der säkularisierten Form wie ein Feuerwerk durch Kultur, Literatur, Geisteswissenschaften zog.
Es ist längst dunkel geworden. Die Zuhörer diskutieren in der kleinen Synagoge weiter, bevor sie zum Maariw-Gebet gehen und es an diesem Schabbatabend mit dem «kiddusch lewana» zum Erscheinen des Neumondes im Garten der Synagoge abschliessen. Ein Stimmengewirr aus «schalom alechem» («Friede sei mit euch») und «alechem schalom» («Mit euch sei der Friede») der Antwortenden rauscht durch den Garten, so wie es die Tradition vorsieht. Der Abend endet mit der «hawdala» und einer Liturgie, die Tradition und Moderne nochmals verbinden soll – auch in einem Text von Rose Cohn. Entrückte jüdische Welten, die in Israels Gegenwart auf einmal so weit weg scheinen und doch immer wieder anzutreffen sind.
An diesem Mozaei Schabbat bleiben die Strassen Jerusalems und die Hotelhallen leer. Alles ist bedächtiger als sonst, auch in Tel Aviv. Gelbe und blau-weisse Flaggen säumen die Einfahrt nach Tel Aviv. Während die Geisel-Plakate am Flughafen Ben Gurion weg sind, bleibt in Tel Aviv das Thema überall präsent. Auf den Strassen fordern Demonstranten die Rückführung der getöteten Geiseln. Inzwischen sind die Lokale und Strassen im Zentrum gefüllt, und es wird sichtbar, wie das diverse Tel Aviv fraktionierter wird. Als ob die Protestierenden ein Israel aus der Vergangenheit anrufen wollten, das es so nicht mehr geben wird, blicken Beobachtende von skeptisch bis belustigt oder ignorant auf das Treiben. Wenige Tage vor dem 30. Jahrestag der Ermordung Itzchak Rabins zeigt sich ein Israel, das damals nicht nur den Friedensprozess, den unideologischen Pragmatismus, sondern auch einen Teil seiner Seele verloren hat – jene Seele, die an diesem Abend im Gespräch mit jungen Menschen in einem Café in Yafo Thema wird.
Junge israelische Studenten mit so vielen verschiedenen Hintergründen, die mit dem Staat ringen, mit der Regierung und den Verwerfungen in der Gesellschaft. Eine starke, intelligente junge Gemeinschaft, so geprägt von den Jahren der Pandemie, nun des Kriegs und den eigenen Erfahrungen mit beiden. Es ist das Café mit dem berühmten Rosmarinkuchen, Schlagrahm und einer Aprikosenkonfitüre mit orientalischer Süsse. Die Filmwissenschaftlerin wurde gerade aus dem Dienst entlassen, der Physiker sinniert über zyklische Naturgesetze einer Phasentheorie der Politik, die naturwissenschaftlich, aber menschlich nie erklärt werden könne. Und so fort. Spannende Gedanken bis tief in der Nacht, überlagert von dieser fortwährenden Frage: Wie soll das alles weitergehen und wo jüdisches Leben eine Zukunft haben?
Die Jungen im Café von Yafo sind mit beiden Beinen in Israel und mit dem Kopf längst nicht mehr dort. Die Filmwissenschaftlerin wird sagen: «Mein Herz ist hier, mein Verstand sagt mir, dass ich auf meine Augen hören soll. Denn wir sehen doch, was hier geschehen ist.» Sie wird das ausführen und in einen Wertekatalog einbinden, der immer wieder auf Itzchak Rabin und auch die Frage referiert, wie man Kriege führt. Der Flughafen bleibt in dieser Nacht leer. Der Souvenirshop fleht regelrecht nach Kundschaft. Der Flieger nach Europa landet in Larnaca, damit die Flugzeugcrew ausgewechselt werden kann. Immer noch wollen die Flugbegleiter nicht in Israel übernachten. Und dann ist er wieder da, der Satz von Rabin: «Wir müssen den Terrorismus bekämpfen, als gäbe es keinen Friedensprozess, und für den Frieden arbeiten, als gäbe es keinen Terror». Eine tödliche Vision, die vielleicht der letzte Ausweg sein wird.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
31. Okt 2025
Die Enkelkinder Rabins
Yves Kugelmann