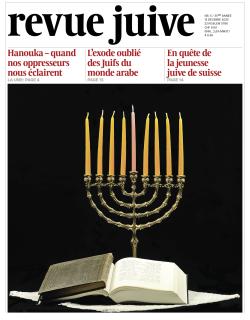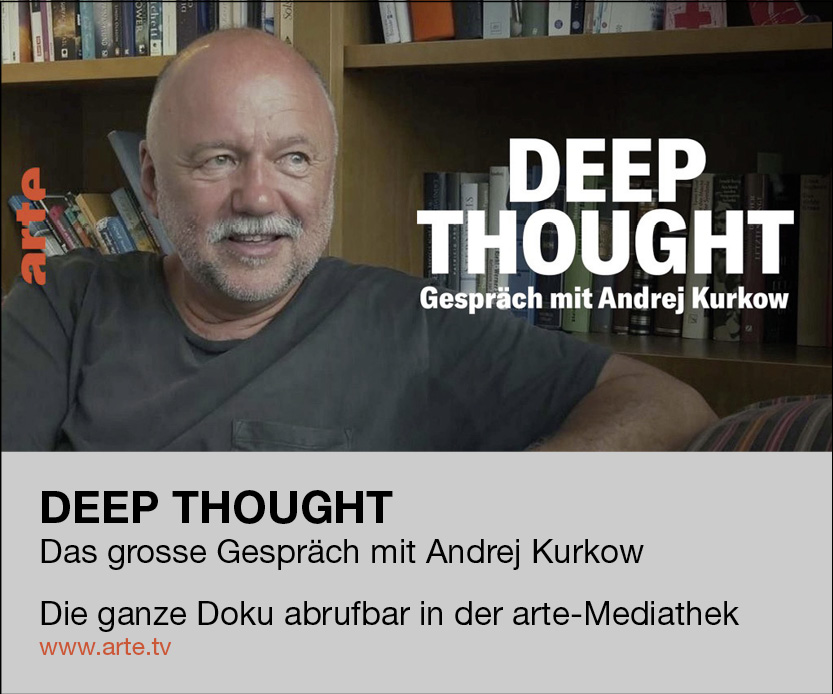Neapel, Oktober 2024. Der Berg ist nicht aus dem Blick zu bekommen. Der Vesuv überragt den Horizont gen Süden. «Er schläft» fügt der Taxifahrer an. Die Verteidigungsminister der G7-Staaten tagen in der süditalienischen Metropole. Der Vulkan wirkt auf die Neapolitaner beruhigend. Die existentielle Gefahr permanent im Blick, haben die Einheimischen das Monster lieben und nicht fürchten gelernt. Die Stadt pulsiert auf ihre Art. In den kleinen Gassen rund um die Via Toledo spielt sich ein faszinierender Alltag ab, zwischen Handwerksbetrieben, Fisch-, Fleisch-, Gemüse- und Obstgeschäften, Kleingewerbe und Restaurants. Da die Gassen, die wie aus einem anderen Jahrhundert wirken mit ihren älteren, oft so armen Menschen. Dort die Gassen, in denen das mondäne Leben pulsiert, mit seinen Galerien, Restaurants oder Modegeschäften. Mittendrin findet sich die Synagoge von Neapel. Es ist die südlichste von Italien. Die Synagoge wurde im Jahr 1864 mit Unterstützung von Adolphe Carl von Rothschild und Samuele Salomone Weil in der Wohnung der ehemaligen Maitresse des britischen Vize-Admirals Viscount Nelson eingerichtet. Für den Minjan reicht es an diesem Sukkottag mit den neun anwesenden Männern, darunter ein Rabbiner aus Rom, nicht. Ein Chasan ist da und die Anwesenden beteiligen sich aktiv am sephardischen Gottesdienst. Es regnet in Strömen und der Kiddsuch findet nicht in der Sukka statt. In Neapel leben nicht mehr viele Juden. Einer ist Professor für Recht an der Universität. Er erzählt davon, dass in der Gemeinde nicht wenige Mitglieder konvertiert sind. Unmittelbar nach dem Holocaust sind die Vaterjuden ins Judentum aufgenommen worden und haben letztlich das Rückgrat der Gemeinde gebildet. Die Synagoge ist ein Bijou und alles wirkt wie aus einer anderen Zeit. Auf die Frage, ob es starken Antisemitismus gebe, antwortet der Professor negativ. Er sage den Studenten jeweils zu Beginn des Semesters in der ersten Vorlesung, dass er jüdisch sei und was er denn tun solle. Damit sei die Sache geklärt. Im Kino unweit läuft der Abspann von «Takin Venice». Der Film handelt von einem Kulturkampf, der heute wieder nochmals ganz anders verstanden wird. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ist die US-Regierung entschlossen, den Kommunismus mit Kultur zu bekämpfen. Die Biennale von Venedig wird 1964 zum Testgelände. Alice Denney, eine Insiderin aus Washington und Freundin der Kennedys, empfiehlt Alan Solomon, einen ehrgeizigen Kurator, der mit bahnbrechender Kunst für Aufsehen sorgt, den US-Beitrag zu organisieren. Zusammen mit Leo Castelli, einem einflussreichen New Yorker Kunsthändler, verfolgen sie den gewagten Plan, Robert Rauschenberg zum Gewinner des Hauptpreises zu machen. Der Künstler wird mit seinen Kombinationen aus Schrott von der Straße und Bildern aus der Popkultur noch nicht ernst genommen, aber er hat das Potenzial, zu begeistern. Mit geschickten Manövern, die aus einem Hollywood-Thriller stammen könnten, lässt das amerikanische Team die internationale Presse aufheulen und Rauschenberg die Politik des Nationalismus in Frage stellen, die ihn dorthin geschickt hat. Zum Abspann läuft der Song von Dave Brubeck und Louis Armstrong «Cultural Exchange» aus dem Musical «The real Ambassadors», das den amerikanischen Kampf um die «Civil Rights» mitten im Kalten Krieg und den Rassenunruhen der 1960er Jahre thematisiert. «Gershwin gave the Muscovites a thrill, (with Porgy and Bess) / Bernstein was the darlin' of Brazil, (and isn't he here?) And just to stop internal mayhem, / We dispatch Martha Graham! That's what we call cultural exchange! /That's what we call cultural exchange!» klingt es in die laue Nacht, die er Vollmond hell erleuchtet. - In Neapel ist nichts vollkommen. Die alten Häuser wirken lebendig mit ihrem Flickwerk. Alles wirkt unaufgeregt und gemächlich. Die vermeintliche Unvollkommenheit vermittelt eine Ruhe, die es in den Gesellschaften kaum mehr gibt, die Perfektion anpeilen. Die Schlaglöcher in Strassen stören nicht, die Imperfektion wird sichtbares Manifest von Wandel und Entwicklung ohne Verdrängung dessen, was einst war. In dieser Szenerie wird alles zur Sukka. Die Volatilität von allem, das Leben im Moment im Angesicht des drohenden Vulkanausbruchs tritt in einen Dialog mit einer Art Existenzialismus, die in der perfekten Welt Klassengesellschaft und in Neapel Gleichheit ausmacht. Die Hafenstadt wirkt authentischer, unmittelbarer und auf eine gute Art rauer als andere. Auf den Strassen spielen Kinder, Generationen von Menschen begegnen und unterstützten sich und vieles lässt die Stadt gar nicht rein. Der Regen hat aufgehört, die Sonne strahlt, als ob der Frühling komme, mitten im Herbst zwitschern Vögel, blüht das Grün der Bäume. Am Horizont vereinen sich die Sukka und der Vesuv, als ob es ein Primat der Zeit sei, dass nichts auf ewig, dass alles nur ein Improvisorium sein mag mit und gegen die Vernunft. Die Millionenstadt am Fusse des Vulkans bleibt ein Rätsel. Wer in aller Welt würde jemals ein Haus bauen im Angesicht der Gefahr? Der Tanz auf dem Vulkan ist keiner. Es ist der Versuch den Puls der Natur zu fühlen mit ihr zu leben und eins zu werden mit ihr. Die «uschpisim» an den Wänden der Sukka erinnern an die Gastfreundschaft, die die Hafenstadt ausmacht. Das Fremde geht auf im Ganzen einer Gesellschaft, die so anders, vielfältig ist und eine Art Wüste bleibt auf Zeit in der Dialektik mit der Natur. Also ob die Sukkotgeschichte angesichts des Vulkans lehren wollte, das alles auf Zeit, der Besitz von Land nicht möglich und der Nationalismus die Kontradiktion zu jeder Lebenswirklichkeit ist und im Siebensiebtenjahr, dem Joweljahr, in die Besitzlosigkeit übergeht. Es ist die jüdische Idee ohne Land und Nation – den Heimatlosen Nomaden durch die Wüsten der Welt.