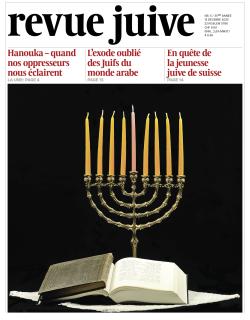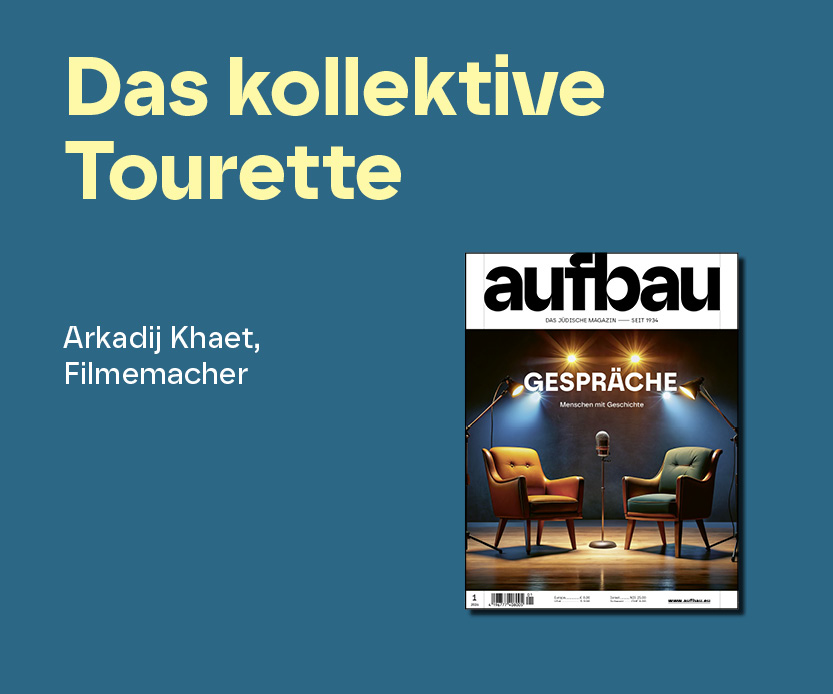Berlin, Juli 2025. Der Engel blickt zurück auf die Trümmer der Geschichte, auf das Trümmerberlin, in dem Walter Benjamin 1892 vor dem Inferno geboren wurde. Die Menschen stehen am Bode-Museum an diesem Julitag Schlange im Berliner Sommerregen. Das geschieht dort nicht so oft. Sie stehen für eine kleine, faszinierende Kabinettsausstellung an. Gezeigt wird der «Engel der Geschichte» zum Wirken und dem tragischen Schicksal des jüdischen deutschen Philosophen Walter Benjamin. Im Zentrum steht seine berühmte neunte geschichtsphilosophische These aus dem Fragment «Über den Begriff der Geschichte», inspiriert von Paul Klees Aquarell «Angelus Novus».
Es zeigt nach Benjamins Deutung einen stilisierten Engel mit aufgerissenen Augen, geöffnetem Mund und weit ausgebreiteten Flügeln. In Benjamins These wird dieser Engel zum «Engel der Geschichte». Sein Blick ist rückwärts auf die Trümmer der Vergangenheit gerichtet, die sich unaufhörlich vor ihm auftürmen. Ein Sturm, der Fortschritt, treibt ihn in die Zukunft, obwohl er verweilen und heilen möchte. Für Benjamin wird das zu einer düsteren Metapher für das 20. Jahrhundert und findet in jeder Generation einen neuen aktuellen Bezug.
Wim Wenders griff das Motiv in seinem Film «Der Himmel über Berlin» (1987) auf, in dem ein Engel über das kriegsversehrte Berlin wacht. Für viele Besucherinnen und Besucher wird es zum treffenden Motiv der aktuellen Gegenwart zwischen Konflikten, Krisen und einem drohenden Tsunami aus der Tech-Welt, die sich zunehmend gegen Menschen richtet. Der amerikanisch KI-Forscher und Philosoph Daniel Kokotajlo, der von 2022 bis Anfang 2024 in der Governance-Abteilung von OpenAI tätig war, bringt es im aktuellen «Spiegel»-Interview auf den Punkt: «Im Jahr 2030 könnte eine KI-Superintelligenz den Schluss ziehen, dass Menschsein überflüssig ist – und sich gegen uns richten.»
Benjamin schreibt: «Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heisst. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Sein Gesicht ist der Vergangenheit zugekehrt. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.»
Der Engel fliegt in die Zukunft, den Blick rückwärtsgewandt gegen den Fortschritt und den Menschen zugewandt, die er zurücklässt. Oder ist es doch nicht der Engel, sondern der erschrockene Sohn Paul Klees? Ist es gar der Golem, von dem Gershom Scholem schreibt: «Der Golem ist ein stummes, hilfloses Wesen. Er gehorcht, aber er versteht nicht. Die Magie, die ihn schuf, kennt kein Gewissen.» Er nimmt Bezug auf das kaballistische Buch «Zohar», aus dem der Mythos des Golem hervorgehen soll. Dort heisst es: «Wenn der Gerechte wollte, könnte er Welten erschaffen – durch die Macht der Buchstaben.» Doch, die Macht der Buchstaben hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die Ungerechten haben sie sich zu eigen gemacht.
Vom Bode-Museum auf der Berliner Museumsinsel fliesst die Spree in Richtung Berliner Ensemble und trifft zunächst auf die Weidendammer Brücke mit dem in Schmiedeisen gegossenen preussischen Reichsadler – mit dem Rücken zum Bahnhof Friedrichstrasse am Fusse des Tränenpalasts, mit Blick zum Engel im Bode-Museum und auf die Kuppel der Synagoge an der Oranienburgerstrasse. Der Adler symbolisiert Macht sowie die Geschichte Preussens.
In der «Ballade vom preussischen Ikarus» nimmt der Deutsch-deutsche Dichter Wolf Biermann nach einer Begegnung mit dem US-Dichter Allen Ginsberg auf der Brücke das Motiv auf. Biermann stellte sich für ein Foto vor den Vogel. Als würden ihm die eisernen Flügel des Adlers wachsen, ringt er mit den Flügeln in die Freiheit. Der Adler wird zum Symbol für Biermanns Hoffnung auf Befreiung und zugleich für das Scheitern dieser Träume im Sozialismus, Kritik an der begrenzten Freiheit im damals zweigeteilten Berlin. 1976 hat er die Ballade erstmals beim berühmten «Kölner Konzert» unmittelbar vor seiner Ausbürgerung aufgeführt.
Der rückwärtsgewandte Engel trifft an der Spree auf den abstürzenden Ikarus, auf die taumelnde Menschheit im Ringen um Freiheit gegen Despotismus, Tyrannei und frei gewählte Unmündigkeit in Richtung Verderben.
Walter Benjamin floh 1940 als jüdischer Intellektueller vor den Nazis über die Pyrenäen nach Spanien, um von dort weiter in die USA zu gelangen. Fortan war es ein kärgliches Leben voller Angst und Armut. Er hatte die Hoffnung, dass hinter den Pyrenäen die Freiheit wartet, will er den sisyphoschen Stein nochmals Hochrollen. In Portbou wurde ihm jedoch die Weiterreise verweigert und mit der drohenden Rückführung nach Frankreich und der Auslieferung an die Gestapo konfrontiert, nahm er sich am 26. September 1940 das Leben. Der Ikarus stürzt, der Engel scheitert. Benjamin trug auf seiner Flucht sein letztes Manuskript bei sich und wollte es unbedingt vor den Nationalsozialisten retten.
Das Bild «Angelus Novus» hatte Walter Benjamin 1921 gekauft und liess es zunächst bei seinem Freund Gershom Scholem in dessen Münchner Wohnung. Nachdem Scholem das Bild Benjamin nach Berlin nachschickte, nahm dieser es auf der Flucht vor den Nationalsozialisten mit ins Exil, wo es zeitweise versteckt wurde. Nach Benjamins Tod gelangte das Bild an Theodor W. Adorno, der es gemäss Benjamins Wunsch später wieder an Gershom Scholem übergab. Heute hängt der «Angelus Novus» als Schenkung im Israel Museum in Jerusalem.
Die Hommage im Bode Museum an Walter Benjamin zeigt ein eindringliches kulturelles Zeugnis darüber, wie Denken, Kunst und Geschichte miteinander verflochten sind. Doch genau diese Kunst ist bedrohter denn je, wenn die Maschinen sie übernehmen. Ansatzweise hat Benjamin in seinem epochalen Essay «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit» von 1935 davor gewarnt.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.