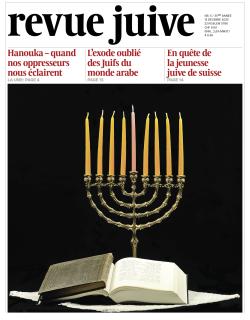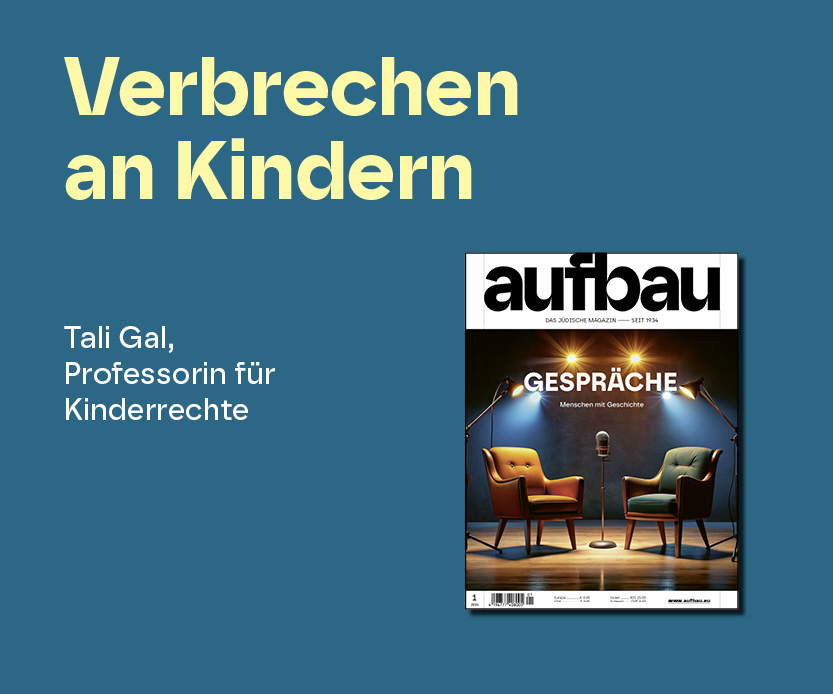Mittelmeer, Juli 2020. Wer an Leib und Leben gefährdet ist, hat Anrecht auf Asyl. Doch was, wenn Armut und nicht Krieg, Politik und Faschismus, wirtschaftliche Aussichtslosigkeit und nicht Ideologien die Existenz von Menschen gefährdet? Diese sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge fliehen vor Armut, Aussichtslosigkeit und Angst. Sie verlassen ihre Heimat, die sie doch nie mehr loslassen wird, und finden sich zum Beispiel in einem Flüchtlingslager am Mittelmeer wie in diesem wieder. Dieser Teil des inoffiziellen Lagers liegt in der brütenden Hitze. Es ist Mittag. An den Essenstellen stehen die Menschen für eine Lunchbox an. Kein Schatten. Viele benützen Kartonschachteln als Schutz gegen die brennende Sonne. Bis zu einer Stunde Wartezeit. Diese Menschen hungern nicht; sie sind nicht mehr auf der Flucht. Doch das Leben in diesen Camps ist hart. Hygiene, Familien- und das ganze andere Leben sind eine tägliche Herausforderung. Ganz zu schweigen von Verlust, Sehnsucht, Unsicherheit und Ungewissheit. Wenn die Nacht anbricht und es kühler wird, getraut sich niemand mehr aus den Zelten oder behelfsmässigen Hütten. Am Hang vor seiner Hütte steht Maschti. Er ist 65 Jahre alt. Seine Frau sitzt um die Ecke am Boden und wäscht Kleider vor der Hütte. Das Gelände ist steil und rutschig, der Boden ausgetrocknet von der Hitze. Schatten gibt es nur in den Hütten, doch auch dort herrschen tagsüber Temperaturen von über 45 Grad. Maschti ist vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet. Seine Frau Faschedi hat sich vor zwölf Wochen auf dem Rückweg vom Waschraum weiter oben im Camp den Fuss gebrochen. Sie hat grosse Schmerzen; eine Operation war nicht möglich. Für die Toilette muss sie den steilen Hang 100 Meter hinaufgehen, Abwasserrinnen überqueren, Betoninstallationen erklimmen. Faschedi klagt nicht, doch ihrem Gesicht ist der Schmerz anzusehen. Maschti war Bauer in Afghanistan. Ihn treibt die Hoffnung. Englisch kann er nicht. Den ganzen Tag sitzt er vor seinem Zelt, viel zu tun gibt es nicht. Er wagt sich kaum raus in die Lagermitte, die von Kindern und jungen Männern bevölkert ist. An der Rückseite seiner Hütte hat Maschti vor einigen Wochen Tomaten zu pflanzen begonnen. Sein ganzer Stolz. Es ist das, was er sein Leben lang getan hat und kann. Inmitten des Camps, zwischen den Hütten, hat er einen kleinen Garten angelegt. Seinen Garten, seine Zukunft. Seine Hoffnung, die ihm die Sorge um Faschedi nicht nimmt. Er versucht es und kann ihr doch nicht helfen. Beide bieten Essen und Trinken an, laden in die Hütte ein. Diese Menschen erwarten nichts, haben nichts – nur diese Kultur von Gastfreundschaft und Zusammenleben. Die Hütten sind sauber, die Menschen gut gekleidet, alles aufgeräumt in einer Umgebung, die nichts bietet: Wasser für Reinigung oder Toilette gibt es unregelmässig. Der Weg führt weiter zu den «Minors». So werden die Jugendlichen und Kinder ohne Eltern genannt. Sie leben in einem eigenen Bereich hinter Drahtzaun. Gesichter und Blicke, die noch tagelang immer und immer wieder auftauchen. Was aus ihnen und den alten Menschen im Lager wird, bleibt ungewiss. Eine Psychologin erzählt, dass die Menschen in den Lagern meist nicht von der Flucht, von der Trennung, sondern vom Lagerleben traumatisiert werden. Weiter unten auf der Strasse führt die Polizei eine Gruppe von 20 Männern ab, die sich eine Schlägerei mit Messern geliefert haben. Alltag in einem Camp, das längst eine Unterwelt etabliert hat, in dem das vermeintliche Recht der Stärkeren gilt. Die Sonne brennt. Das Laufen durch das Labyrinth, über Hügel, durch eine verwinkelte und oft willkürliche Anordnung von Hütten wird beschwerlich. Die Luft steht regelrecht. Für den Tee von Maschti ist es zu heiss. Minze aus dem Garten der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der alten Heimat, in die er mit seiner Frau nicht mehr zurückgehen, wo er seine Felder nicht mehr sehen und die restliche Familie nicht mehr treffen kann. Der Schmerz, die Verletzungen, die Trauer in dieser Fremde werden bleiben. Auf immer.
Das jüdische Logbuch
31. Jul 2020
Garten der Sehnsucht

Yves Kugelmann