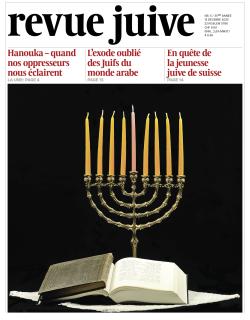Aix-en-Provence, August 2019. «Nach 500 Jahren in Deutschland ist meine Familie vom Aussterben bedroht.» – Der traumhafte Monet mit dem venezianischen Dogenpalast, der Cézanne mit dem Berg St. Victoire, der van Gogh mit den Bergen von Saint Rémy, Picassos Tauben, Abendgesellschaft und die Frau mit den gelben Haaren wirken farbenstark klar, auf dem Vorplatz des Kulturzentrums Caumont brennt die Sonne senkrecht und schattenlos runter. Das New Yorker Guggenheim Museum zeigt die legendäre Thannhauser Collection in der Provence und erzählt zugleich die dramatische Geschichte des jüdischen Kunstsammlers aus Deutschland. Geboren 1892 als Sohn eines Kunsthändlers, arbeitete Justin Thannhauser in der 1904 gegründeten Modernen Galerie in München. 1919 eröffnete er eine Dependance in Luzern, dann 1927 in Berlin, wohin er dann den Hauptsitz verlegte. Ab 1933 bemühte sich Thannhauser um eine erneute Verlegung seines Geschäfts ins Ausland und emigrierte 1937 nach Paris, wo er bis 1940 eine Galerie führte. Nach der Besetzung beschlagnahmte die deutsche Wehrmacht die Bilder. Es gelang ihm mit einem Teil seiner Sammlung nach New York zu flüchten, wo er ein drittes Mal einen Neuanfang wagte. 1963 stiftete Justin K. Thannhauser seine private Sammlung und die seines Vaters dem Guggenheim-Museum als Thannhauser Collection. Denn Erben hat er keine mehr, und eine deutsche Geschichte ging nach 500 Jahren langsam zu Ende. Die Odyssee der Familie und der Kunst, die Enteignungen und Vertreibungen gingen Hand in Hand mit dem tragischen Familienschicksal. Thannhausers Sohn Heinz fiel 1944 im Krieg, sein zweiter Sohn Michel erlag 1952 einer schweren Krankheit, seine Frau Kate starb 1960. Er selbst starb 1976 in New York. Die Ausstellung mit 50 Meisterwerken aus der Thannhauser Collection erzählt die Geschichte des Impressionismus entlang jener der Sammlerfamilie, der Galerie auf beeindruckende Weise und damit ein Schicksal zwischen Passion für Kunst und jüdischer Leidensgeschichte. Und damit auch unausgesprochen die Geschichte so vieler Juden im 20. Jahrhundert zwischen Aufbruch, dem Glauben an die Emanzipation der Gesellschaften und totaler Zerstörung. Im Oktober 1938 fand das letzte Freundschaftsdiner des Kunsthändlerverbands Syndicat des éditeurs d’art et négociants en tableaux modernes statt. Der Fotograf Henri Manuel hat diese vereinte Tafel in einem berühmten Foto festgehalten. Gaston Bernheim-Jeune, Paul Pétridès, Justin K. Thannhauser, Pierre Loeb, Léonce Rosenberg, André Schoeller, «Madame Pierre Loeb», Josse Bernheim, «Madame Gulliaume Leray» und Paul Rosenberg. Mit den Sammlern Daniel-Henry Kahnweiler oder Paul Cassirer setzten sie sich jahrzehntelang für die europäische Moderne ein und blickten auf finstere Zeiten und die totale Entzweiung unter jüdischen und anderen Sammlern. Die jüdischen Kunsthändler flüchteten, andere kollaborierten mit den Nazis. Auf Beschlagnahmung und Enteignung folgten oft erst spät die Aufarbeitung von Raubkunst, die Provenienzforschung und manchmal eine Rückerstattung. Museen von USA bis Europa oder Israel vereinen heute viele dieser Kunstsammlungen jüdischer Erbschaft, die revolutionären Werke im Aufbruch zur Moderne mit dem Vermächtnis, sie der Öffentlichkeit vollumfänglich zugänglich zu machen.
Der St. Victoire unweit von Aix-en-Provence strahlt auch an diesem Tag mit seiner markanten Felswand im hellen Sonnenlicht zwischen blauem Himmel und grünen Wäldern. Das Faszinosum, das in Paul Cézannes Werk in so unzähligen Interpretationen auftaucht bleibt eng verbunden mit der Geschichte der Sammler. So steht Henri Matisse’ Zitat am Anfang der Ausstellung mit einem Male in einem neuen Kontext: «Ich träume von einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit, der Ruhe, ohne beunruhigende und sich aufdrängende Gegenstände, von einer Kunst, die für jeden Geistesarbeiter, für den Geschäftsmann so gut wie für den Literaten ein Beruhigungsmittel ist, eine Erholung für das Gehirn, so etwas wie ein guter Lehnstuhl, in dem man sich von physischen Anstrengungen erholen kann.» Unschuldige Kunst wird dadurch Teil der tragischen Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Die Ausstellung im Hôtel de Caumont ist noch bis zum 29. September zu sehen.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
16. Aug 2019
Schuldige Unschuld am St. Victoire
Yves Kugelmann