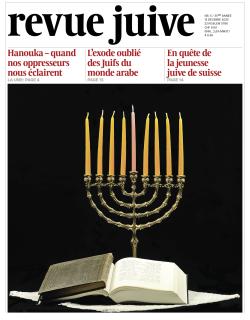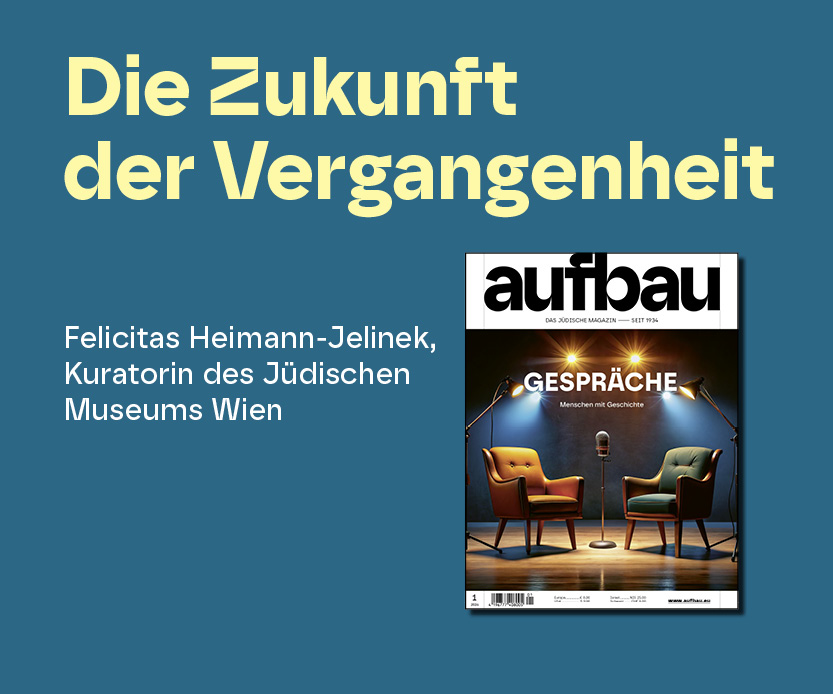Strassburg, Juli 2025. Die Fahrt mit dem gemächlichen Zug durchs Elsass, durch die blühenden Felder mit ihren kleinen Dörfern, ist wie eine Zeitreise. In Strassburg ist Plenarwoche des Europäischen Parlaments, die Schulferien haben schon begonnen, und in den Strassen in Strassburgs Neustadt spielt sich das jüdische Leben weiterhin auf der Strasse ab. Die Stadt ist weiterhin ein europäisches Zentrum jüdischen Lernens und Lebens, das viele das Jerusalem Europas nennen.
Das Elsass gehörte seit 1871 abwechselnd zu Deutschland und Frankreich und wurde nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag wieder französisch. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es von Nazi-Deutschland annektiert, viele Elsässer wurden zwangsrekrutiert. Bis heute prägt die wechselvolle Geschichte die elsässische Identität zwischen deutscher und französischer Kultur. Bis zur Schoa war die jüdische Gemeinde im Elsass eine der ältesten und vitalsten in Europa. Zeugnisse der zahlreichen jüdischen Gemeinden im ländlichen Raum sind immer noch zu sehen: Synagogen, Friedhöfe, ehemalige Gemeindehäuser, Gedenksteine. Während der deutschen Besatzung 1940–1944 wurden die Juden aus dem Elsass vertrieben, deportiert oder ermordet – viele flüchteten in den unbesetzten Süden Frankreichs oder wurden über Drancy in Konzentrationslager verschleppt. In St. Louis, Colmar und vor allem Strassburg gibt es noch aktive Gemeinden. Das jüdische Buchgeschäft in Strassburg ist nach rund 50 Jahren von einem jungen Ehepaar übernommen worden. Sie aus Algerien, er aus Marokko. Die jüdische Gemeinschaft wächst und wandelt sich. Einst war dies ein aschkenasisches Zentrum, heute sind viele sephardische Jüdinnen und Juden zugewandert. Anders als im übrigen Europa ist die jüdische Gemeinschaft weniger stark von den Anfeindungen seit Ausbruch des Gaza-Kriegs im Nachgang zum 7. Oktober 2023 getroffen. Die junge Mutter im nahegelegenen koscheren Lebensmittelmarkt erzählt vom Wandel der letzten Jahre. Die jüdische Gemeinschaft lebe zwar weitgehend unbescholten, wie einst, oft Haus an Haus mit muslimischen Migranten. Doch zugleich habe man sich zunehmend aus der Stadt zurückgezogen. Ausserhalb der Neustadt gäbe es vermehrt Antisemitismus. Die junge Frau bleibt weitgehend im «jüdischen» Quartier. Das elsässische Judentum verändert sich zugleich. Im Buchgeschäft zeugt viel Literatur von den elsässischen jüdischen Traditionen mit ihren so vielfältigen eigenen Rezepten, dem elsässischen jiddischen Idiom, eigenem Rhythmus und vielen Geschichten und Geschichte. Entstanden ist vieles davon auch im Kontext des bis heute geltenden Sonderrechts für jüdische Gemeinden im elsässischen Bas-Rhin und Haut-Rhin, das aus der Zeit Napoleons stammt. Jüdische Gemeinden sind dort wie katholische und protestantische Kirchen öffentlich-rechtlich anerkannt, und der Staat bezahlt Rabbinergehälter. Dieses «lokale Recht» blieb erhalten, weil die Region zwischen 1871 und 1919 deutsch war und nach der Rückkehr zu Frankreich nicht vollständig laizisiert wurde. Es erlaubt bis heute auch jüdischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen – im Gegensatz zum übrigen Frankreich. Im Kontext der aktuellen Gegenwart stellt sich auf einmal die Frage nach dem Verhältnis von Religion, ethnischen Minderheiten und Staat neu. In der Auslage liegt das neue Buch von Didier Meïr Long und Dov Maïmon, «La fin des juifs de France?». Die Autoren analysieren die wachsende Unsicherheit französischer Juden angesichts von Antisemitismus, gesellschaftlicher Ausgrenzung, Gewalt, und fragen, ob jüdisches Leben in Frankreich langfristig überlebensfähig ist – oder ob Auswanderung die realistischere Perspektive wird. Die Analyse ist ein Warnruf und ein Plädoyer für politisches Handeln, das sich im Elsass nochmals ganz anders liest. Die junge orthopraxe Buchhändlerin auf jeden Fall ist nach Strassburg gekommen, um zu bleiben. Sie hat eine junge Familie, sorgt für ein breites Buchsortiment im Bereich Kultur, Gesellschaftspolitik, religiöse Bücher und arbeitet gerade an einem Youtube-Programm zum Thema liberale Politik und jüdische Tradition in Frankreich. Die Lektüre von «Les juifs d’Alsace et de Lorraine de 1870 à nos jours» von Freddy Raphaël beschreibt, wie sich die einst rural geprägten jüdischen Gemeinden nach der Emanzipation im 19. Jahrhundert zu einem integralen Teil der französischen Gesellschaft wandelten, dabei ihre lokale jiddisch-elsässische Kultur bewahrten und trotz deutscher Annexionen sowie antijüdischer Gewalt Widerstand und Anpassung leisteten, wie die Schoa und die Gründung Israels wirkte und zeigt, was für so viele jüdische Gemeinschaften im Maghreb oder etwa Osteuropa und Russland galt und gilt: Die jüdische Erfahrung ist Sesshaftigkeit auf Zeit – wenn es sein muss. Da ist auch Strassburgs Gesellschaft weit über den Integrationswillen der jüdischen Gemeinschaft neu gefordert.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
11. Jul 2025
Gehen oder bleiben?
Yves Kugelmann