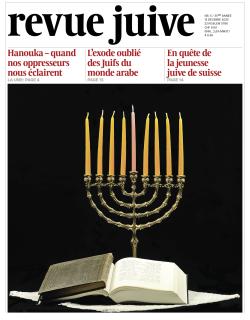Europa, November 2019. Was macht Europa aus? Trägt Europa den Juden und Israel gegenüber eine besondere Verantwortung? Oder andersrum gefragt: Welcher Verpflichtung müsste Europa im Umgang mit humanitären Fragen nachkommen?
In diesen Tagen fliessen Geschichte und Gegenwart zusammen. Jahrestage in Erinnerung an den Mauerfall vor 30 Jahren oder die Reichspogromnacht vor 81 Jahren entfachen Debatten der Gegenwart neu. Das letzte Jahrhundert mit seinen zwei grossen Kriegen sowie der Kalte Krieg – alles ist irgendwo Hintergrund, ständig das Europa von heute am Begleiten, ständig am Her-
ausfordern. Das neue Europa ist eine Konstruktion, die demokratischste der Weltgeschichte. Sie ist keine nationale, noch nicht mal eine ökonomische, aber bis jetzt immerhin noch eine Wertegemeinschaft. Wenn rechtspopulistische Parteien Aufwind kriegen, Rassismus und Antisemitismus Herausforderungen der letzten Monate bzw. eher Jahrzehnte darstellen, wenn der Europäische Gerichtshof Produkte «Made in Israel», die aus der Westbank stammen, verbietet oder wenn ein belgischer Karneval antisemitische Karikaturen zulässt – was bedeutet dies für Europa? Soll all dies dem politischen Diskurs, allenfalls Behörden oder zum Teil Gerichten überlassen werden, oder gilt hier die historisch verpflichtete Ausnahme? Und falls ja: Woran soll sie sich orientieren? Wer soll das diskutieren? In den letzten Jahren sind diese Themen vermehrt Lobbyisten und Funktionären überlassen und dem gesellschaftlichen Diskurs entzogen worden. Antisemitismusbeauftragte, konkurrenzierende jüdische oder israelische Organisationen in Brüssel oder in anderen europäischen Parlamenten versuchen Themen zu besetzen und zu diktieren, die nicht zuerst von dogmatischen Interessenvertretern aufgezwungen werden dürfen. Europas Wertgemeinschaft geht mit der historischen Erfahrung einher, an die zu Recht noch lange erinnert werden soll, ohne allerdings den Blick für Gegenwart und
Zukunft zu verstellen. Was also macht Europa aus? Zuerst die Verbindlichkeit der verbrieften Werte, die allem voran Freiheit und Offenheit garantieren. Beide bedeuten, dass es vieles auszuhalten gilt. Manchmal sogar Rassismus und Antisemitismus, was nicht verboten, sondern nur bedingt geahndet werden kann. Wenn Selbstregulierung gesellschaftlichen Frieden garantieren soll, so ist evident, dass Erziehung zur Freiheit Teil eines jeden Schulcurriculums wird. Erziehung im Sinne von Aufklärung und nicht Verziehung. Dann werden Mehrheiten Minderheiten und fragile Errungenschaften immer schützen und sie nicht bedrohen.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
Das Jüdische Logbuch
15. Nov 2019
Geschichte verpflichtet – oder nicht?
Yves Kugelmann