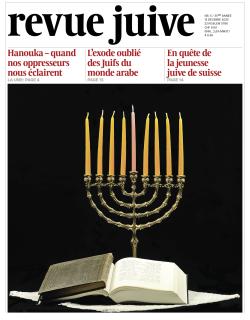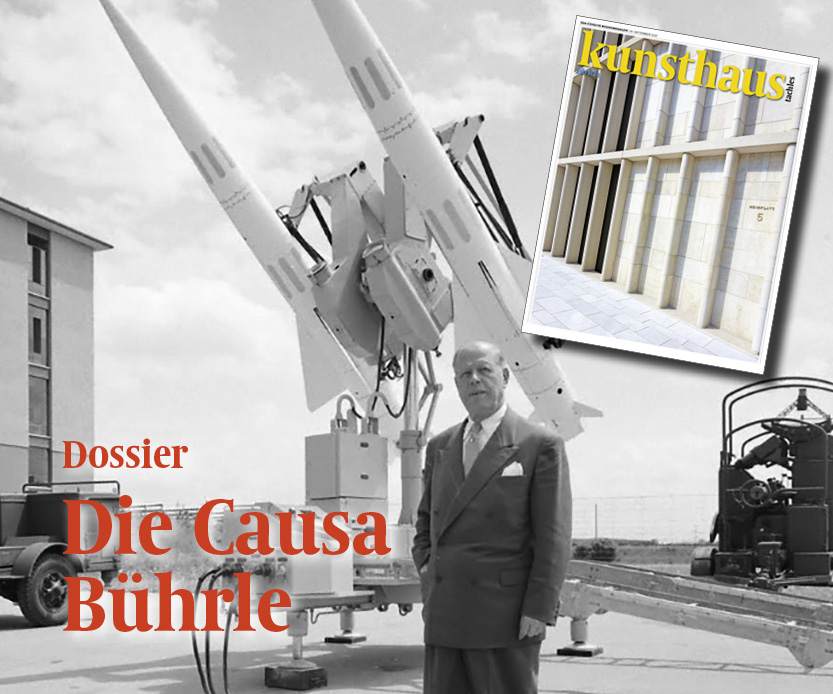Warschau, April 2025. Polens Hauptstadt ist im permanenten Wandel. Das Erscheinungsbild wird immer westlicher, Hochhäuser und Glaspaläste verdrängen die einst so präsente belastete Geschichte des Landes. Das Judenviertel ist kaum mehr zu finden, der ehemalige Ostblock wird pulverisiert und viel Geschichte verdrängt – und doch flackert sie auf. Die Nozyk-Synagoge verschwindet immer mehr hinter den Betonüberbauungen, und das jüdische Erbe der Stadt wird geradezu virtualisiert. Die einst so bedeutende jüdische Metropole ringt mit ihren rund 15 000 Juden um eine Zukunft zwischen Weltpolitik und Erinnerung. Das Ringelblum-Archiv, das jüdische Museum Polin, das Anelewitsch-Denkmal, Mila 18, Umschlagplatz, das Ghetto-Mahnmal, der eindrückliche jüdische Friedhof sind vor allem Anziehungspunkte für Touristen und kaum mehr wahrnehmbar. Unweit davon beten am Gründonnerstag Gläubige für den kranken Papst Franziskus.
Polen hat sich mit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs fundamental geändert. Einst auf der Kippe zu autokratischen Entwicklungen, haben Proteste gegen einen Entscheid des Verfassungsgerichts zum Abtreibungsverbot ab 2021 zu einer neuen Dynamik geführt, die vielleicht die rechtskonservative Regierung die letzten Wahlen gekostet hat. Die Ukraine ist mit dem Auto in zwei Stunden erreichbar. Rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine hat Polen aufgenommen. In drei Wochen stehen in Polen richtungsweisende Präsidentschaftswahlen an. Der amtierende Präsident Andrzej Duda darf nicht mehr kandidieren.
Polen hat den EU-Ratsvorsitz, der Reformkurs der amtierenden Regierung hat für ein Europa mit zunehmenden Demokratiedefiziten und rechtsextremen Entwicklungen Signalwirkung. Polen gibt seit Jahren mehr als drei Prozent des Bruttoinlandprodukts für Verteidigung aus und bestimmt die neue Sicherheitsarchitektur Europas massgeblich. In diesem Jahr werden es fast fünf Prozent sein, während sich das polnisch-amerikanische Verhältnis unter Trump von einer engen Partnerschaft zu einer vorsichtigen Distanz entwickelt, geprägt von geopolitischen Spannungen und innenpolitischen Veränderungen. Das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland bleibt aktuell von einer Mischung aus Annäherung und anhaltenden Spannungen geprägt.
In einem Raum mit Blick auf das Denkmal von Stefan Kardinal Wyszyński erörtert ein ehemaliger ranghoher polnischer Politiker vor Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen der Zivilgesellschaft die geopolitische Lage. Er nimmt vielen die Befürchtung, dass die baltischen Staaten Russlands nächstes Kriegsziel seien, und wendet den Blick auf «abtrünnige» Staaten wie Kasachstan oder Georgien. Das Gespräch wird bis tief in die Nacht dauern – eines in dem jeder Satz schon eine andere Dimension allein durch die Stadt erhält, in dem er gesagt wird. 80 Jahre nach der Befreiung stellt Putins Matrix, Trumps Libertarismus die Weltordnung von 1945 zur Disposition.
Und auf einmal lesen sich die Texte von Historiker Emanuel Ringelblum und Gründer des Untergrundarchivs «Oneg Schabbat» in Warschau kurz vor Jom Haschoa in einem anderen Kontext: «Alles ist wichtig. Nichts ist unwichtig. Schreib alles auf, was du siehst.» Man hofft, dass die Schriften, die Aufzeichnungen, die Tagebücher, die Geschichten der Opfer oder Überlebenden gelesen werden, um zu verstehen, aus was Demokratien nach 1945 und 1989 hervorgegangen sind – und was auf dem Spiel steht.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
25. Apr 2025
Downtown Europa
Yves Kugelmann