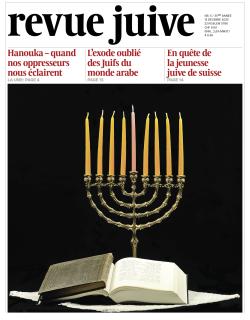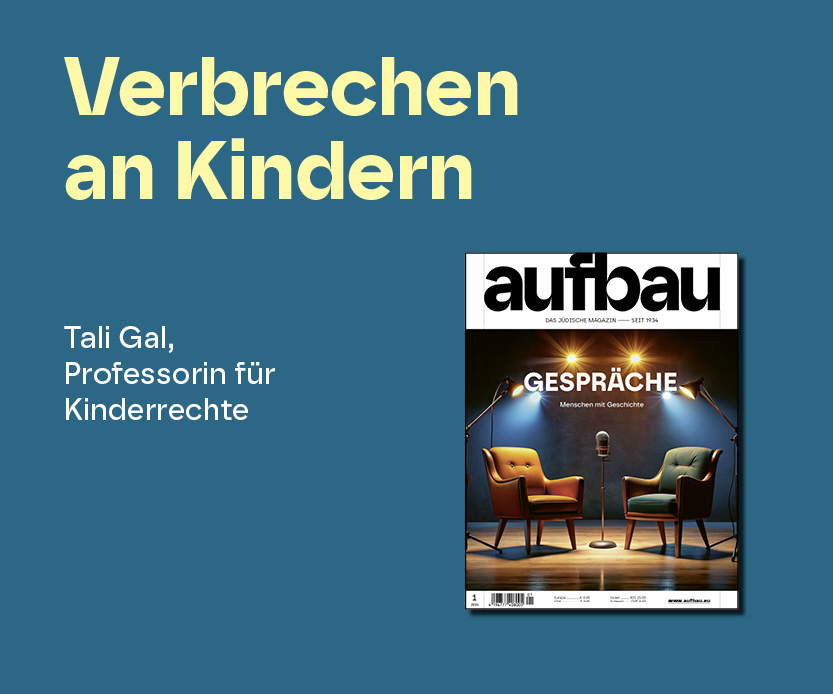Jerusalem, Dezember 2024. Die Vögel zwitschern immer noch. Immer noch liegt eine Ruhe über der Stadt. Der Blick schweift hinunter in die Jordantalebene. In der Ferne glitzert das Tote Meer. Die Luft ist schon warm in der winterlichen Dezembersonne. Die Altstadt Jerusalems erstrahlt in der Sonne. Ostjerusalem südwestlich darunter. Vom Har Hazofim erschliesst sich die Schönheit der kargen Landschaft im Sonnenspiel. Vom Weltdrama der abrahamitischen Religionen im Steinlabyrinth ist nichts zu bemerken. Die Hebräische Universität ragt über die Stadt und leuchtet bereits frühmorgens im Licht. Die Studentinnen und Studenten mäandern durch die endlosen Gänge und Wege im Universitätspark. Viele Frauen tragen ein Kopftuch. Einer der leitenden Angestellten der Uni spricht über Herausforderungen auf dem Campus nach dem 7. Oktober: «Ein arabischer, ein jüdischer Student wurden von der Uni verwiesen. Um eine arabische Professorin gab es eine Kontroverse.» Die Universitäten in Israel sind seit der Einsetzung der amtierenden Regierung im Januar 2023 zum Rückgrat der Demokratiebewegung geworden. Meinungsäusserungsfreiheit, Forschung zur israelischen Demokratie oder der Umgang mit Minderheiten im Land werden hochgehalten. «Wir spüren den Konflikt tagtäglich. Viele internationale Forschungsprogramme leiden unter dem Krieg und den Boykotten von Israels Universitäten.» An diesem Tag sind viele ausländische Forscher für eine Konferenz auf dem Campus. Es wird offen und respektvoll debattiert. Es ist das alte Israel, das auf dem Mount Scopus wieder auflebt. Yonat ist Historikerin, lebt in einem Kibbuz südlich von Jerusalem. «Der Angriff auf die Kibbuzim vom 7. Oktober hat auch unseren Kibbuz verändert. Nach den Massakern haben wir uns alle alleine gefühlt, im Stich gelassen von Behörden und Regierung.» Sie erinnert an die Geislen und sagt: «Viele von unseren Jungen dienen in der Armee und setzen sich für dieses Land ein.» Yonat ist im Kibbuz geboren und aufgewachsen. Das ist ihr Leben. Doch heute überlegt sie sich, ob das alles noch eine Zukunft für sie und ihre Familie habe. Eitan von der medizinischen Fakultät sagt: «Wer heute nicht Nationalist oder religiös ist, findet kaum mehr eine Heimat im Land.» Auch auf dem Campus sind an allen Ecken Tafeln in Erinnerung an die Geiseln zu sehen. – Ein paar Stunden später sitzt Sari in Silwan. Sie ist Muslima, ihr Bruder wurde am Tag vor seinem 18. Geburtstag verhaftet, weil er Steine geworfen hat. Durchs offene Fenster sind die israelischen Bulldozer zu hören. In Silwan unmittelbar neben der Stadtmauer, werden zehn Häuser von arabischen Familien zerstört. «Die Behörden sagen, die Häuser seien vor 25 Jahren illegal gebaut worden», sagt eine ältere Frau im Raum. Keine Aggression. «Die Behörden nutzten das Momentum. Niemand schaut im Moment hin.» Draussen auf der Strasse laufen Kinder von Siedlern, die inzwischen in Silwan leben, mitten unter den Arabern. Streng bewacht.–Was soll aus all dem werden? In der israelischen Regierung wird derweil immer noch über Bevölkerungstransfer, Besiedlung von Gaza, der Westbank und dem Golan debattiert. Beim Tee auf der Terrasse sagt Eitan: «Die Juden ausserhalb Israels müssen sich jetzt endlich mehr engagieren. Unsere Demokratie retten. Wir werden das alleine nicht mehr schaffen, nachdem so viele ausserhalb Israels Geld ins rechtsextreme System gepumpt haben.» Dani ist Zionist von einst. Grossvater. Einer, der sich nicht vorstellen kann, das Land zu verlassen. Für ihn ist Israel die Erfindung der jüdischen Diaspora mit der Möglichkeit, dort sesshaft zu werden. «Es war nie die Idee, dass Israel zur Bedrohung von Jüdinnen und Juden wird. Doch genau das geschieht im Moment schleichend.» Die Stadt leuchtet golden im Sonnenuntergang. Die Ruhe ist wieder eingekehrt. Also ob nie etwas gewesen sei.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
20. Dez 2024
Die Vögel am Har Hazofim
Yves Kugelmann