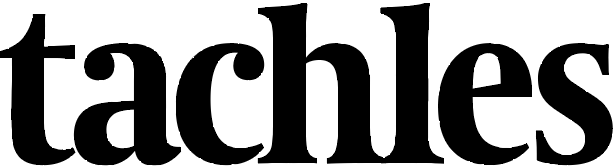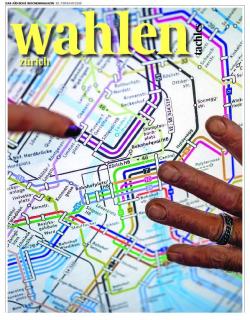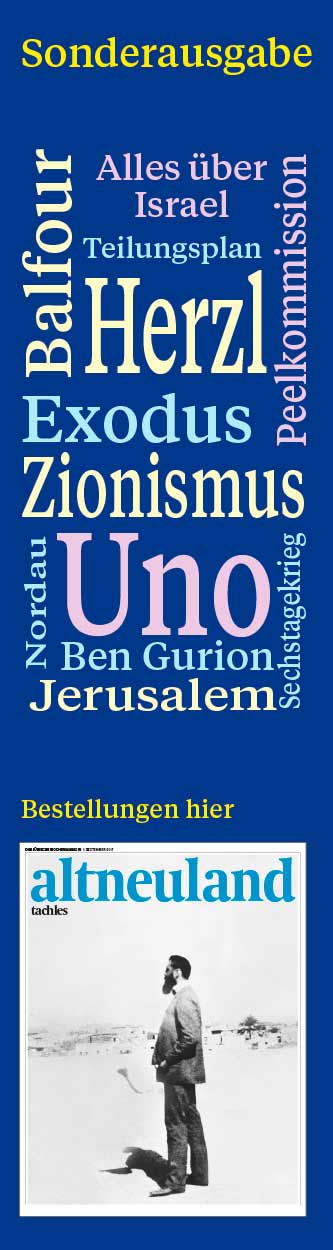Geschichten von Menschen im Krisengebiet in Israel, an der Front und aus der Zivilgesellschaft. In dieser neuen tachles-Kolumne porträtiert die Autorin Menschen im Krisengebiet.
Plötzlich ist es Winter geworden in Israel. Am bislang freundlichen Himmel bilden sich jäh bedrohliche Wolken. Dichter Regen fällt unerwartet und heftig auf die Ebenen von Sharon, die Hügel Judäas, auf Frauen, Kinder, alte Menschen – ein Wetterumschlag, der wie eine weitere biblische Plage zwischen dem Mittelmeer, dem Jordan und dem Roten Meer Schlammmassen fliessen lässt.
Mit gebrochener und doch lauter Stimme betet der Vater von zwei von der Hamas seit sechs Wochen als Geiseln gehaltenen kleinen Töchtern auf dem Marsch nach Jerusalem: «Gott, bitte mach, dass unsere Kinder in Gaza wenigstens vor der Kälte geschützt sind!»
Ich habe mich unter die Familien der Geiseln gemischt, in die Masse von annähernd 30'000 Menschen, die die Familien in die Hauptstadt begleiten. Sie verlangen, vom Kriegskabinett und dem Premierminister empfangen zu werden. Seit fünf Tagen marschieren sie: 65 Kilometer, um die Angst zu bekämpfen, um vereint zu sein, als einzig verbliebener Schutzwall gegen das Grauen und die Indifferenz. Wenn man sie anspricht, zeigen sie mit dem Finger auf die Gesichter ihrer Liebsten, die auf ihren T-Shirts aufgedruckt sind – Onkel, Tanten, Nichten, Kinder aus den Kibbuzim Beeri, Kfar Aza und Nir Oz.
Mit Tsafra zähle ich ihre Familienmitglieder, die am 7. Oktober entführt oder getötet worden sind. Sieben Mitglieder einer «normalen» Familie. Tsafras Lächeln ist dünn, als sie sagt: «Siehst Du, vor dem Krieg wusste niemand, verstand niemand, wo wir wohnen. Die Touristen sagten: Was, ihr wohnt in der Nähe von Gaza? Wie ist das nur möglich? Vielleicht hätten wir ihnen öfter Landkarten zeigen sollen, damit sie unsere Nähe zu unseren früheren Nachbarn verstanden hätten.»
Als die Marschierer beim Sitz der Regierung ankommen, verlasse ich die Gruppe, um zum Zelt zu gehen, das weiter unten vor dem Eingang zur Knesset aufgebaut wurde. Vor einem langen weissen Zelt stehen Tische voller Lebensmittel und Wasserflaschen, ein elektrischer Wasserkocher surrt vor sich hin. Ein friedlicher Hund, den Kopf auf den Oberschenkel von Rami gelegt, seufzt. Seine Schnauze liegt dort nicht bequem wegen des M16 Gewehrs, das er sanft zur Seite zu schieben versucht. Erfolglos. Auf den weissen Plastikstühlen sitzen Männer mit verschlossenen Gesichtern. Bewaffnet, wörtlich und im übertragenen Sinn.
Guy trägt ein T-Shirt seines Geburtsorts, des Kibbuz Nir Oz. Ich frage ihn, wo er jetzt wohnt, und er zeigt mit dem Kinn auf das Zelt. «Hier», sagt er, «ich bleibe hier, bis er verschwindet.» Er, das ist der Premierminister, dessen Namen er vor lauter Zorn nicht aussprechen kann. Er sagt nur: «Er und seine Bande.» Jeden Morgen steigt Guy in sein Auto und fährt nach Tel Aviv, wo er als Diamantenschleifer arbeitet. Abends kehrt er zurück, um neben seinen Kampfgenossen zu schlafen. Gute Seelen – und von denen gibt es viele – holen Guy und seine Leidensgefährten ab, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu duschen, sich umzuziehen, sich eine Pause zu gönnen. Guy erzählt: «Meine Eltern sind über 80 Jahre alt, sie wurden aus ihrem eigenen Haus entführt. Wir wurden im Stich gelassen, getäuscht, fallen gelassen. Wir wissen, dass die Regierung nicht funktioniert. Es ist das Volk, das hier ist, das rettet, das hilft, das etwas tut.»
Die Marschierer drängen sich vor dem Podium, das in aller Eile auf der Strasse aufgebaut wurde, die zur Knesset und zum weissen Zelt führt, dem provisorischen Haus von Guy, Rami, Ilan und den anderen. Sie stimmen die «haTikwa» an, bevor sie gelbe Ballone mit den Namen der Geiseln in den Himmel aufsteigen lassen, wo sie mit dem Wind zu kämpfen haben. Wer verstehen will, was in Israel vor sich geht, zwischen dem Meer und dem Jordan, muss nur die Gesichter dieser Frauen, Männer und Kinder anschauen, die sich in dieser Manifestation versammelt haben. Oder ihre Augen und Blicke.
Etwa jene des Mannes, der mit fester Faust eine blau-weisse Fahne trägt, auf der steht: «Frei sein in unserem Land». Das ist die sechste Zeile eines kurzen Gedichts von Naftali Imber, des in der Ukraine geborenen und in New York verstorbenen Poeten. Er war der erste jüdische Beatnik, ein Nomade - aber diesem Land mit den tiefsten Gefühlen verbunden. Oder die leeren Augen jener jungen Frau, die ihr Gesicht an die Schulter ihres Begleiters kuschelt. Oder jenen alten Mann, der verstört und mit fahlem Gesicht auf dem Rand des Trottoirs sitzt. Ich versuche ein vorsichtiges «Geht es?», er erhebt sich schwerfällig, schaut mich an und murmelt: «Es ist eine Tortur, es ist eine Tortur.» Er lächelt schwach und flüstert: «Mach dir keine Sorgen.»
Ich streife auch später noch unter ihnen umher, in der Menge auf dem Vorplatz des Tel-Aviv-Museums. Sie schauen zur Bühne, wo die Familien der Geiseln flehentliche Aufrufe machen. «Jetzt! Jetzt! Holt sie jetzt zurück! Jetzt!» Die Menschenmenge dreht dem Tor zur Kirya den Rücken zu, jener Militärbasis, in der derzeit unter anderem die Diskussionen über eine mögliche Befreiung der Geiseln geführt werden.
Ich gehe hinter der langen Silhouette eines Mannes im Gehrock und mit schwarzer Kippa auf dem Kopf. Er dreht sich um, schaut mich an. Er hat einen langen roten Bart, seine blauen Augen sind klar und fröhlich. Eyal, der Rechtsanwalt, der nach einer langen Mitgliedschaft im ganz linken Flügel der Meretz religiös geworden ist, ist auch hier. Aber er streift nicht umher wie ich, er spricht leise und erklärt: «Siehst du die Leute hier? Sie sind verloren, weil sie glaubten, ihr Leben, ihr Land und die anderen unter Kontrolle zu haben.» Wir vereinbaren, uns am nächsten Tag im Dorf Kfar Chabad zu treffen. Der Donner grollt, Eyal hebt die Augen hoch zum Himmel und auch er sagt mit fester Stimme: «Mach dir keine Sorgen. Bis bald.»