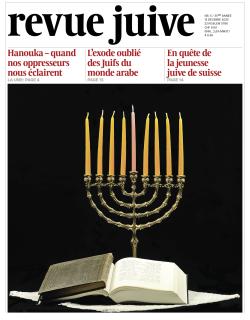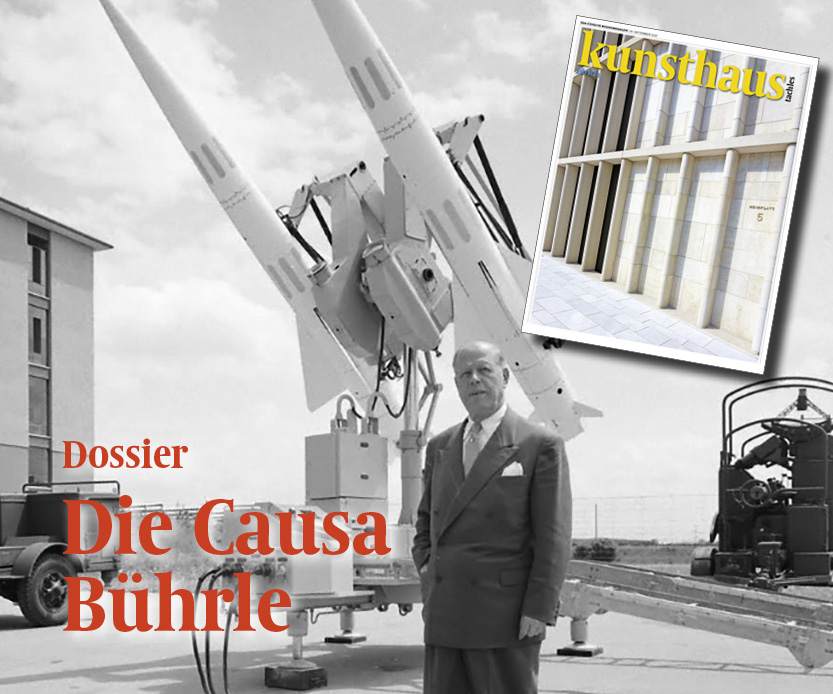Cannes, Mai 2024. Cannes ist nicht Berlin. Politik spielt sich dort beim Filmfestival auf der Leinwand und nicht auf dem roten Teppich ab. Kein billiger Aktivismus, keine vulgären Stellvertreterkriege oder Missbrauch des öffentlichen Raums. Zumindest bis jetzt. Das mag sich bei der Preisverleihung morgen Samstag noch ändern. Bis dahin bleibt Cannes die Plattform des Dialogs gerade auch mit israelisch-palästinensischen, israelischen, arabischen Filmen oder unzähligen Veranstaltungen. Auf dem Markt, bei Veranstaltungen sprechen Israeli, Araber, Juden und Muslime natürlich über Krieg und Konflikt miteinander. Dann überrollt die Aussen- wieder jene Welt, die die reale vorwegnehmen oder zumindest kontextuieren will. Irans Präsident Ebrahim Raisi und Aussenminister Hussein Amir-Abdollahian sterben bei einem Helikopterabsturz, Israels Premiere Binjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Joaw Galant sollen vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Kriegsverbrechen eingeklagt werden, tags darauf kündigen Spanien, Norwegen, Irland eine mögliche Anerkennung eines Palästinenserstaates an, gleichentags machen Berichte die Runde, dass eine Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien und somit Bemühungen der Biden-Regierung von Netanyahu blockiert würden. International isoliert sich Israel zusehends – oder wird isoliert. Kaum sind die Proteste an Universitäten abgeflacht, folgen in den Augen vieler Menschen neue Hiobsbotschaften. Kein Tag vergeht ohne neue Debatten, angereichert mit verbalen Eskalationen auf allen Seiten. Es sind die Nachbeben von 7/10. Die internationale Welt, die Menschen auf der Strasse reagieren – falsch, richtig, gerecht, ungerecht, in alle Richtungen. Am Mittwochabend schliesslich rütteln Video-Aufnahmen von Hamas-Geiseln die Israeli auf, es kommt zu Protesten auf den Strassen. Die Operation der israelischen Armee in Rafah bleibt umstritten, Medien publizieren Satellitenbilder der massiven Fluchtbewegungen der palästinensischen Zivilbevölkerung. Und weiter geht das Kaffeesatzlesen des Publikums dieser Tragödie mit weltweitem Ausmass.
In einem Interview mit der Tageszeitung «Die Welt» erinnert die Geschichtsprofessorin Fania Oz-Salzberger auf die Frage nach der dieswöchigen Anerkennung Palästinas durch westliche Staaten, die auch als Belohnung für jahrelangen Terror gesehen werden könnte, mit einer Anekdote ihres Vaters, des Schriftstellers Amos Oz: «Was ist der Unterschied zwischen einer Tragödie von William Shakespeare und einer von Anton Tschechow? In einer Shakespeare-Tragödie ist die Bühne am Ende voller Leichen. In einer Tschechow-Tragödie sind am Ende des Stückes alle wütend, enttäuscht, desillusioniert, blossgestellt. Aber sie leben. Ich möchte, dass der israelisch-palästinensische Konflikt wie bei Tschechow endet und nicht wie bei Shakespeare.» Eine Tragödie mit Happy End im Sinne des Humanismus wider den Nationalismus. Was auf der Bühne funktioniert, braucht in Demokratien Mehrheiten. Die Eskalation von realen Ereignissen und verbalem Schlagabtausch hat sich längst zwischen die Menschen geworfen und eine Situation geschaffen, die noch weniger als sonst ein ganz richtig und ganz falsch ergibt und auf Kompromisse hinauslaufen muss. Oder in den Worten von Oz-Salzberger: «Wenn diese Leute kategorisch ‹Nein› sagen, sind sie an Frieden schlicht nicht interessiert. Jede ‹From the River to the sea›-Rethorik zielt entweder auf die Auslöschung von Israel oder auf die Vertreibung aller Palästinenser ab.» Dualität, von der viele lernen können auf roten Teppichen, Universitäten oder der Strasse.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
24. Mai 2024
Das 7/10-Nachbeben
Yves Kugelmann