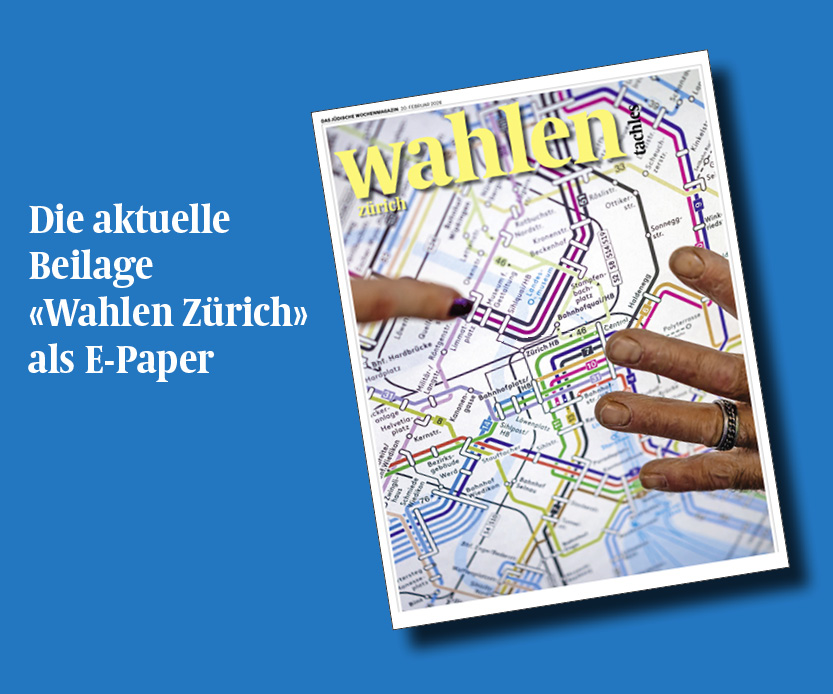Basel, Februar 2021. Stellen Sie sich vor: Die Eidgenössische Rassismusfachstelle hat ihren neuesten Bericht über Rassismus 2020 publiziert. Oder besser gesagt: den Bericht über rassistische Vorfälle in der Deutschschweiz. Denn in der Romandie liegt sie im Streit mit einer privaten NGO, die einen anderen Rassismusbericht publiziert. Für das Tessin wiederum fühlen sich beide im Wetterrennen der Zahlenerhebungen nicht verantwortlich. Erhoben werden diese Zahlen nach dem Zufallsprinzip mit einer Mischung aus Meldungen oder Eigenrecherche. Methoden werden selbst entwickelt, nicht abgeglichen, Autoren und Mitarbeiter des Berichts nicht genannt und die Willkür zum Prinzip erhoben. Ausführlich werden in Einleitungen thematische, personelle oder andere Versäumnisse ausgeführt und diese als föderalistische Errungenschaft schöngeredet. Der eine Bericht kommt zu Ergebnissen auf dem Niveau der letzten Jahre. Der andere zu dreimal höheren für ein viel kleineres Territorium als der andere. Beide preschen damit in die Öffentlichkeit. Der eine bringt den Bericht mit aufwendiger PR-Arbeit vornehmlich bei befreundeten Redaktionen unter, der andere irgendwie anders. Um aber den Eindruck zu erwecken, dass die eine Organisation dann doch für die ganze Schweiz zuständig sei, sendet die eine «Fachstelle» die «nationale Synthese Rassismus in der Schweiz» schon zehn Tage vor Publikation mit Sperrfrist an die Medien, bekommt aber die nötigen Zahlen des anderen erst am Tag der Publikation. – Richtig: Diese Schindluderei hat natürlich in der Realität nie stattgefunden und wäre eigentlich eine Purimposse. Natürlich würde niemand auf die Idee kommen, Rassismus in der Schweiz so zu erheben. Nicht so bei der Erhebung von Antisemitismus in der Schweiz. Da spielt sich das Szenario über zehn Jahren in der Schweiz in etwa so ab. Dass Medien den Bericht vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) unreflektiert übernehmen und ohne richtige Einordnung verbreiten, zeigt ein anderes Problem der Thematik in der Schweiz, die es so bei einem ähnlich gelagerten Rassismusbericht nie geben würde. – Zwei Juden, drei Antisemitismusberichte, das darf nicht sein. Denn diese Berichte sind nicht Selbstzweck für falsch verstandene PR, sondern sollten ernsthafte Grundlage für strategische Entscheidungen etwa im Gespräch mit Behörden sein. Wer solche Daten aber nicht erheben kann, soll es nicht tun, sondern eingestehen, dass eine unabhängige nicht Interessen gesteuerte Fachstelle mit einer einheitlichen, glaubwürdigen, sachdienlichen, wissenschaftlich verifizierter Methode hilfreicher wäre. Die Kritik ist nicht neu, aber berechtigter denn je: Denn Recherchen im Gespräch mit ehemaligen oder aktiven Mitarbeitern bzw. Funktionären fördern zutage, dass man in den verantwortlichen Organisationen selbst seit langem nicht nur um die Mängel weiss, nichts dagegen unternimmt, sondern den Kniefall im Korsett von selbstgemachten Problemen, Interessenkonflikten und Streitigkeiten bevorzugt. Rund fünf Organisationen (SIG, CICAD, GRA, Licra, Eidgenössische Kommission gegen Rassismus) sowie punktuell noch andere befassen sich in der Schweiz mit Antisemitismus. Anstatt Ressourcen zu bündeln und Kompetenz zu steigern, versucht man in der Öffentlichkeit zu beschönigen, was man beim genaueren Hinschauen nicht einlösen kann. Dass nun der neue SIG-Präsident Ralph Lewin bei diesem Trauerspiel nicht die Notbremse gezogen, sondern im Vorwort zum Bericht seinen Segen gegeben hat, diesen in der Öffentlichkeit verteidigt, mag ihn als solidarischen Menschen ehren, macht die Sache aber nur noch schlimmer. Denn Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung eignen sich nicht für Sandkastenspiele, sondern sind gerade in diesen Tagen virulente gesellschaftliche Herausforderungen mit seismographischem Zweck. Dabei geht es nicht darum, so viel wie möglich Antisemitismus zu finden oder jenen schön zu reden, den es gibt, sondern es gilt, glaubwürdig, redlich und professionell richtig zu arbeiten. Dazu gehört auch das systematische Monitoring der rechts- und der linksextremen Szenen, bei Neonazis und im Darknet, anstatt Corona-Platitüden über Verschwörungstheorien und punktueller Social-Media-Recherche zur Kür anstatt zur Pflicht zu erheben. Antisemitismus entsteht nicht im Affekt, sondern wächst in Gesellschaften über lange Dauer. Dass sich die Schweizer Realität mit Attacken auf jüdische Veranstaltungen und Synagogen im Jahre 2021 anders darstellt, als der SIG-Bericht 2020 antizipiert, liegt nicht in der Verantwortung des SIG. Doch es zeigt, wie unzulänglich sein eigener Bericht ist. Anders ist nicht zu erklären, dass kurz nach Publikation des Antisemitismusberichts der Verband in einem Newsletter Hinweise auf die aktuellen Ereignisse nachlieferte (vgl. S. 6, 12, 14).
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
26. Feb 2021
Was wäre, wenn …?
Yves Kugelmann