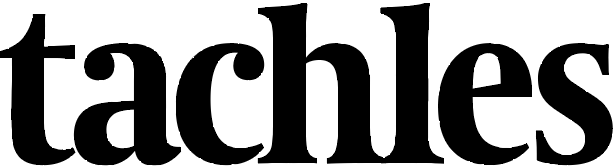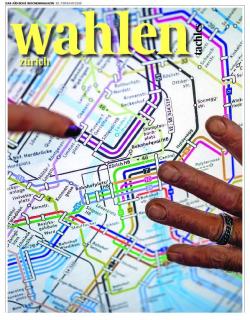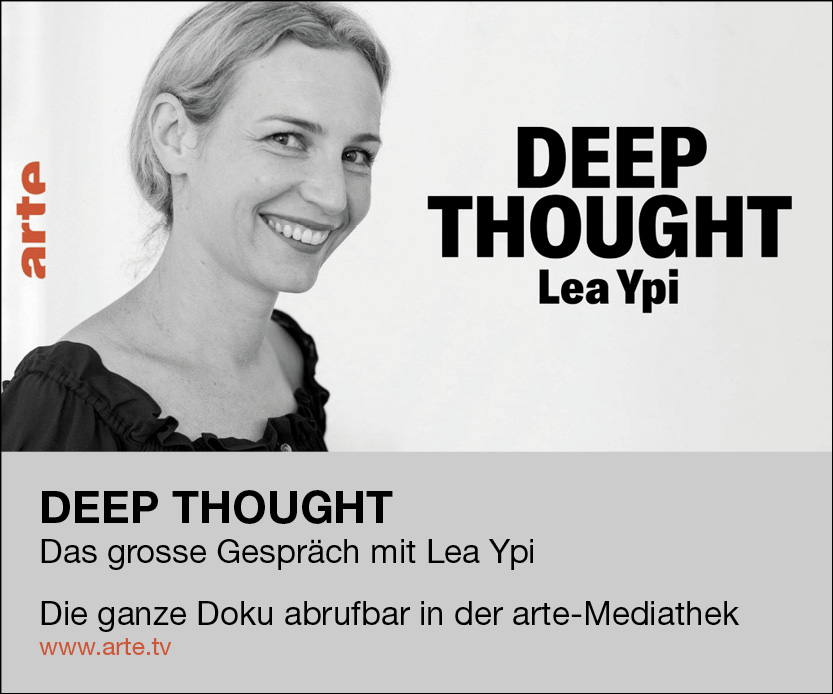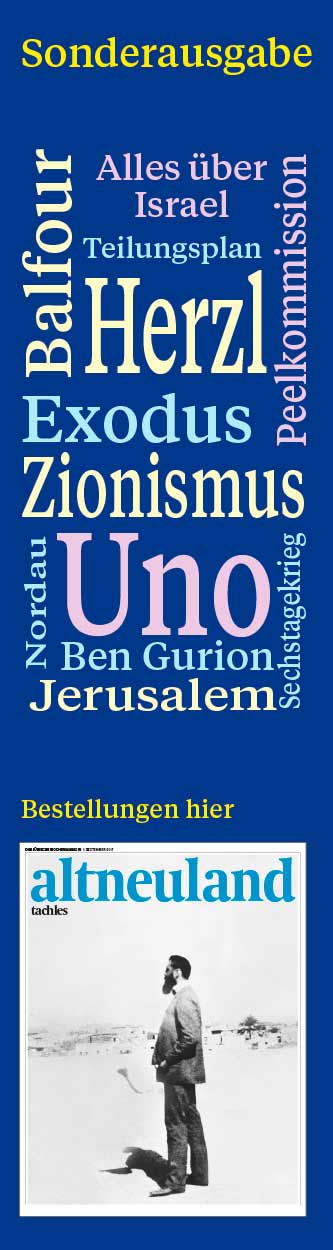Bern, Juni 2024. Der Gang durch die Arkaden Berns ist immer auch ein Spaziergang in und durch eine andere Zeit. Auf dem Weg zur Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) klingen Mani Matters Lieder im Ohr «Mir hei e Verein» oder «Nei säget sölle mir», erinnern an eine zeitlose Dialektik, die solchen Versammlungen gut tun würde. Der SIG ist ein Verein. Der Verein seiner Mitglieder. Das sind die Mitgliedsgemeinden. Die liberalen Juden oder einige orthodoxe Gemeinden sind nicht Mitglieder, ebenso wie die grösste Gemeinschaft der Schweizer Jüdinnen und Juden – nämlich jene, die nicht in Gemeinden organisiert sind. Der SIG vertritt je nach Statistiken etwas mehr als die Hälfte der Schweizer Jüdinnen und Juden. Die Innen- und Aussenwahrnehmungen prallen immer wieder aufeinander bei den jährlichen Delegiertenversammlungen. Selten gibt es eine tiefgreifende Diskussion, selten werden Dossiers verhandelt, Ereignisse diskutiert. Einiges wird an-, selten ausgesprochen und fast gar nie richtig diskutiert zu allen Fragen der Ausrichtung, politischen Dossiers, Kommunikation, Verbandsprojekten etc. Viel Formales, Alibiübungen und über allem immer der Zeitdruck einer Versammlung, die kaum Raum für mehr als die Verlautbarungen der Exekutive zulässt. Da bekommt ein neu gewählter Präsident dann auch nicht wirklich Redezeit. Das alles entspricht viel mehr diesem Dürrenmatt-Bern als der Jahrhunderte gewachsener jüdischer Diskussions- und Streitkultur. Dafür ist nicht die aktuelle Kriegs- und Traumasituation im Nachgang zum 7. Oktober verantwortlich, sondern das Selbstverständnis eines Verbands, der jeweils ein hohes Mass an Selbstzufriedenheit und minutenlange Lobreden auf die Führung der Geschäfte von sich gibt für Dinge, die nicht Kür, sondern schlicht Job des Gemeindebunds sind, genauso wie die Bischofskonferenz die Interessen der katholischen Kirchen und somit Katholiken im Lande vertritt oder die Rega Bergsteiger in Not rettet. Der Gemeindebund ist ein auf Theologie basierender Verband und sollte nicht tun, als ob er etwas anderes sei. Die Evaluation von Verbands- und Projektarbeit durch Externe wird nicht zugelassen und wenn mal eine externe Stimme mit grösster Vorsicht angehört wird, dann so wohl gewählt, dass die beidseitige Hürde der Furcht, etwas «Falsches» gesagt zu bekommen, kaum überschritten wird. Eine Selbstausgrenzung der besonderen Art steht im Kontrast zu einer Wirklichkeit, die sich ausserhalb des SIG seit Jahren und verschärft in den aktuellen Monaten zeigt. Gemächliche, voraussehbare Verbandsarbeit, die die Aufklärung anruft und sie selbst nicht immer so gerne zur Maxime des eigenen Handelns macht, mit einer Prioritätensetzung, die an Delegiertenversammlungen nicht diskutiert wird. Die Nettozeit der Diskussion mit den Delegierten nach der Rede zu 120 Jahren SIG von Ralph Lewin im Vorfeld der DV war kaum höher als 30 Minuten. Die wenigen Voten wurden kaum diskutiert und das Setup des «Austausches» so angesetzt, wie ein Schwimmbad ohne Wasser, in das man ja nicht reinspringen sollte. All das hat etwas Anachronistisches und kumuliert in den vielen spannenden Aussagen von Delegierten, die sie leider nur hinter vorgehaltener Hand statt im Plenum einbringen. Weshalb? Aus Feigheit? Aus Angst? Es gibt die falsche verstandene Haltung im SIG, immer allen beweisen zu wollen, wie toll und gut man sei. Verbandsarbeit mit Ricola-Werbung zu verwechseln («Wer häts erfunden») ist nicht nur lächerlich, sondern verhindert, was wichtig ist: eine zivilgesellschaftliche Arbeit ohne permanentes Konkurrenzdenken mit Alleinvertretungsanspruch. Unterschiede zwischen vermeintlichen Innen- und Aussenwelten müssen nicht kaschiert werden, vorgegeben werden mit einer «Swissjews»-Stimme – wie es die Webseite des Verbands suggeriert – sprechen zu können und alles an der Frage zu, ob nun die «Tagesschau» auf SRF oder das «Echo der Zeit» über die DV möglichst so berichten, wie das vorab kanalisiert wurde. Der Reflex, dass die freie Presse und jede Form kritischer Disziplin etwas Bedrohliches sei und mit viel Kommunikationsaufwand kontrolliert werden sollte, ist stammt noch aus Ghetto-Zeiten – wo das allenfalls gut begründet war. Der SIG könnte sich da ein Beispiel an Israels Diskussionskultur nehmen und die Verrohung derjenigen in den letzten Jahren aussen Vorlassen. Der Wunsch nach Anerkennung und Lob mag verständlich sein. Doch ist es die völlig falsche und eine sich selbst begrenzende Prämisse für eine Arbeit, die Teil der Aufklärung und damit der Blick nach vorne sein sollte. Eine Arbeit, die viel Geld kostet, die dem jüdischen Alltag der Menschen und inzwischen auch der Zivilgesellschaft entzogen wird. Wer meint, dass die Lösung sei, dass der Staat die Aufwendungen des SIG und einer Projekte über teils nötige Sicherheitskosten hinaus bezahlen müsse, hat nicht verstanden, was integrale Partizipation in einer Gemeinschaft bedeutet, zu der man nicht gehören möchte, sondern sich als Teil davon, als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, verstehen sollte. «Kunscht isch gäng es Risiko» sang Mani Matter einst und forderte den aufrechten Gang in die Gesellschaft aus der vermeintlich sicheren Wagenburg. Es sind politische und herausfordernde Zeiten, die kein Schweigen, sondern offenes Reden wider die Beliebigkeit einfordern. Das wusste schon Friedrich Dürrenmatt, der die Nostalgie der schlafenden Dörfer als Rahmen und nie als Bild darin sah: «Ideologie ist die Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens.» Dieses Weiterdenken mit viel Partizipation wäre so wünschenswert im Jahr 1 nach dem 120. Jubiläum.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
07. Jun 2024
«Mir hei e Verein»
Yves Kugelmann