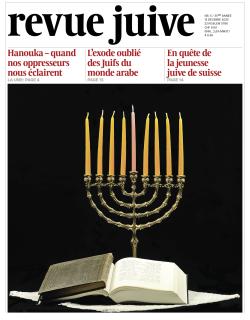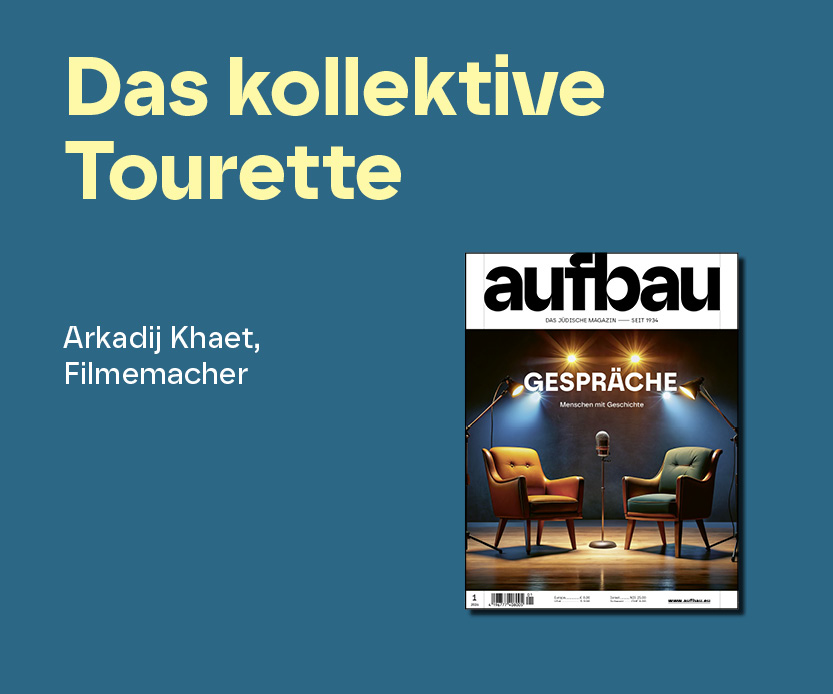Berlin, September 2020. Laufen durch Berlin ist Mäandern durch greifbare Geschichte. Auf dem Weg ins Auswärtige Amt im ehemaligen Osten, neben Berlins Bebelplatz mit dem Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung von 1933, der Blick auf die wiederaufgebaute Staatsoper Unter den Linden und das nachgebaute Berliner Schloss mit Humboldtforum. Ein Slalom zwischen Original, Kopie, Zerstörtem, zwischen 1918, 1939, 1949, 1989 und vielen Stolpersteinen. Berlin verdichtet 100 Jahre Weltgeschichte und mit ihr ist auch die jüdische Frage immer wieder präsent. Auch in diesen Tagen anlässlich der Feierlichkeiten zu 30 Jahren deutscher Einheit. Eine historische Erfolgsgeschichte mit Abstrichen, die sich in Rechtspopulismus und -extremismus manifestieren. In diesem Jahr hat Deutschland nicht nur den Ratsvorsitz in der Europäischen Union inne, sondern präsidiert auch die International Holocaust Remembrance Association (IHRA). Vorsitz hat Michaela Küchler, die schon seit Jahren mit einem kleinen Team ein beachtliches Engagement an den Tag legt. In den nächsten Tagen wird Deutschland die Antiziganismus-Definition der IHRA präsentieren. Ähnlich wie die Antisemitismus-Definition soll nicht nur Diskriminierung von Sinti und Roma in der Gegenwart, sondern auch deren Geschichte in Europa bewusst gemacht werden, dies kurz bevor die Europäische Kommission ihr neues Zehn-Jahres-Programm für Sinti und Roma präsentiert. Ein brisantes Thema, wenn man bedenkt, wie Sinti und Roma bis heute staatlich ausgrenzt und auch gesellschaftlich oft nicht akzeptiert bleiben, bei Wiedergutmachung für Holocaust-Verbrechen oft hintanstehen müssen. Wie einst auch in der Schweiz während der Debatte um die sogenannten nachrichtenlosen Konten steht inzwischen auch der Zentralrat der Juden in Deutschland an der Seite der Sinti Roma.
Es geht vorbei an den Hackeschen Märkten ins Centrum Judaicum im Gebäude der Neuen Synagoge Berlin mit seiner hervorragenden Ausstellung zu den Fotografien von Magnum-Fotograf Robert Capa über das Berlin der Befreiung 1945 und jener unvergesslichen, aber wenig bekannten Fotografie der in Berlin versteckten und überlebenden Juden beim ersten Gottesdienst mit einer Thora. Tucholskystrasse, Bahnhof Friedrichstrasse, wo 1988 noch vor der Wende eine Delegation des Fussballclubs JTV-Basel mit viel Respekt vor Grenzsoldaten die Grenze nach Osten passierte, Checkpoint und Kalter-Krieg-Atmosphäre. Inzwischen ist alles anders. Wenig weist auf die Geschichte hin. Ein Denkmal für die Kinderopfer in der Schoah – und dann ab in den Westen zum Bahnhof Zoo. Es ist Freitagabend, Kabbalat Schabbat. Die Synagoge an Joachimsthalerstrasse wurde 1902 erbaut als Logenheim und hat selbst eine bewegte Geschichte. Der Minjan ist zügig zusammengekommen, trotz Pandemiebestimmungen. Und es zeigt sich rasch, dass Migration oder früher Vertreibung und Flucht zentraler Bestandteil einer lebenden jüdischen Gemeinschaft sind. Es sind vorwiegend ehemalige russische Kontingentsflüchtlinge oder deren Nachkommen, die vor Ort sind. Im Vorhof zur Jüdischen Literaturhandlung spielen Kinder. Die Liturgie aschkenasisch und viel Gesänge mit Melodien von Louis Lewandowski bis Shlomo Carlebach, intoniert vom hervorragenden Chasan Arie Zaloshinsky, begleitet von Rabbiner Itzchak Ehrenberg und der ganzen Gemeinde; einer lebendigen Gemeinde, die es ohne Migration und zum Teil nicht einfacher Integration so kaum geben würde und die heute eine Regierung an ihrer Seite weiss, die jüdisches Leben fördert und unterstützt. Zuletzt auch mit der Entscheidung von letzter Woche, als die Bundesregierung nochmals 22 Millionen Euro für die Sicherheit der jüdischen Gemeinden gesprochen hat. Mäandern durch Geschichte und Kulturen ist letztlich das Erlaufen von Europas Migrations- und Minderheitengeschichte.
Das jüdische Logbuch
02. Okt 2020
Mäandern durch Geschichte und Gegenwart

Yves Kugelmann