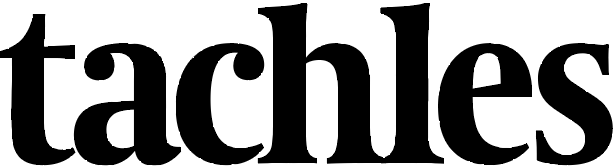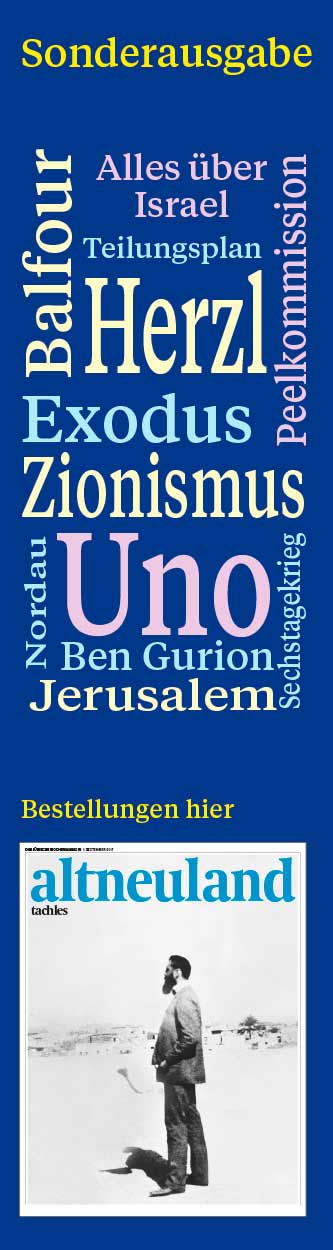Berlin, Februar 2021. Berlins berüchtigter Ostwind bläst ins Gesicht. Die Stadt ist rauer als sonst schon. Die Sprache ist es auch geworden. Mit der Pandemie hagelt es Verordnungen und Anweisungen von Behörden, Politik, aus der Privatwirtschaft und ebenso der Zivilgesellschaft. Überall Hinweise, Plakate, Newsletter, Instruktionen, Anweisungen. Die Zeit der Verordnungen, der Amtssprache, der Entfremdung selbst im direkten Gespräch mit Menschen in Geschäften, Öffentlichkeit, bei Institutionen, in Schulen, auch in jüdischen Gemeinden. Hin-, An- oder Zurechtweisung. Die Sprache der Pandemie ist eine technische, eine hierarchische, eine emotionslose. Eine Sprache mit wenig Empathie für die vielen, die sich so Mühe geben im Alltag. Die Eltern, die Kinder, die Einsamen, die Gesellschaft. Eine Sprache, die die wenigen meint, die so eine Sprache vielleicht erreichen muss. Eine Sprache, die die Mehrheit nicht braucht. Eine Sprache wie aus einer anderen Zeit. Eine Sprache ohne Geduld. Eine Sprache der Obrigkeit, der Klassengesellschaft. Eine Sprache, die bei Sicherheitskontrollen am Flughafen, am Zoll, oft bei Behördengängen die kalte Atmosphäre ausmacht. Eine Sprache ohne Lächeln. Eine funktionale Sprache. Eine Sprache, die sich längst in den Alltag hineingedrängt hat und eine Sprache, die von so vielen einfach übernommen wird. Die zeigt sich überall – auch bei der Kommunikation jüdischer Gemeinden und Organisationen. Eine Sprache, die zu Beginn der Pandemie vielleicht einmal nötig war und es vielleicht längst nicht mehr ist. Die Pandemie ist Teil der Normalität – auch wenn der Alltag noch keinen normalen Umgang mit ihr finden kann. Eine Sprache ohne Grossmut, ohne Leichtigkeit, ohne leichte Ironie verhärtet. Der Berliner Kurt Tucholsky schrieb schon: «Wer auf andere Leute wirken will, der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen reden.» Die inzwischen eingebürgerte Sprache der Pandemie haben die Menschen nicht verdient. Der Berliner Theater- und Literaturkritiker Arthur Eloesser hatte da seine Vermutung: «Noch schlimmer, als von grossen Herren ist es, von kleinen Leuten regiert zu werden.» Regiert durch Sprache allen voran. Die kleinen Leute, die von grossen Herausforderungen überrannt werden, vielleicht ihr Bestes tun wollen und doch nicht können. Diese oft vermeintlich kleinen Leute könnten grosse Leute sein und werden. Diese Menschen in den geschützten Werkstätten der Bürokratie, Administration, Organisation, die über andere Menschen befinden und in ihr Leben eingreifen sollen. «Die Welt vergisst schnell, besonders wenn sie ein Schlagwort in den Ohren hat», schreibt Eloesser weiter. Doch die Pandemie darf nicht zum Schlagwort und die Kultur des Zusammenlebens nicht vergessen werden. Der eisige Wind ist schon rau genug. Die warmen Worte aus Berlins geschlossenen Kaffeehäusern, aus den Theatern, den gesellschaftlichen Zusammenkünftigen, die warmen Worte der Freiheit wären das erste Mittel gegen Folgen des Virus.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
12. Feb 2021
Die Sprache der Pandemie
Yves Kugelmann