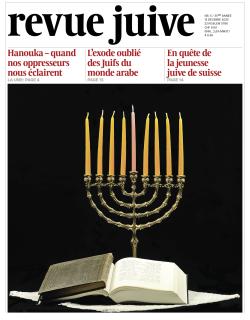Leipzig–Berlin, März 2025. Das Buch lebt. Die Leipziger Buchmesse zieht Zehntausende vorwiegend junger Menschen an. Die Tickets sind längst ausverkauft, im grössten Buchgeschäft der Welt, verteilt über sechs Hallen, gibt es kaum ein Durchkommen. Während aus Europa mit verstörtem Blick nach Amerika geschaut wird, wo vor aller Augen eine Revolution gegen die Demokratie stattfindet, setzt die Buchmesse ein Kontrastprogramm mit starken Titeln zu Demokratie und den Verwerfungen in der Welt. In der Stadt finden Festivals, Lesungen und unzählige Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren statt.
In Zeiten von «book bans», Angriffen auf die Freiheit von Wissenschaft und Medien hat die Messe etwas doppelt Erfrischendes – und nichts von der Berliner Eskalationsunkultur zu Konflikten rund um Nahost oder den Ukraine-Krieg: keine Störungen von Veranstaltungen, aber viel Aufklärung und Plattformen des Dialogs. Viel Sauerstoff für erstickende Debatten.
Kultur, Begegnung, Bildung – das präsentiert das Ariowitsch-Haus in Leipzig. Im Jahre 1931 wurde es als jüdisches Altenheim eröffnet, gestiftet von der gleichnamigen Familie. Damals wohnten in Leipzig 30 000 Juden. Im September 1942 wurden alle 108 Bewohner und Mitarbeiter des Altersheims nach Theresienstadt deportiert. 1946 wurde das Haus der jüdischen Gemeinde zurückgegeben und existierte bis 1997 als Altenheim. 20 Juden lebten in Leipzig.
Heute hat die jüdische Gemeinde in Leipzig wieder rund 1200 Mitglieder. Im Rahmen von «Leipzig liest» findet im Haus das Festival «Jüdische Lebenswelten» statt. Mikołaj Łoziński spricht über sein von der Kritik viel gelobtes Buch «Stramer – Ein Familienroman», und Katja Petrowskaja über das Buch «Als wäre es vorbei» und darüber, wie der Krieg die Bilder oder den Blick darauf verändert.
Die Synagoge ist nur einen Katzensprung entfernt. Beim Besuch am Schabbat findet sich nicht nur eine lebendige jüdische Gemeinde – es wird auch manifest, wie die Zuwanderung russischer Juden nach der Wende und aktuell ukrainischer Flüchtlinge den Alltag prägen. Der Blick in den Gemeindesaal beim Kiddusch mutet an wie jüdische Gemeinschaften auf alten Fotos aus Osteuropa vor der Wende. Die Klarinette hallt weit hinein in die Strassen um den Leipziger Markt. Ein Musiker spielt «Take Five», und unweit davon stehen «Die Omas gegen Rechts». Sie mahnen wöchentlich vor Rechtsextremismus und der Stärkung der AfD. Gegenüber die Graffiti «Support Israel», die überall in der Innenstadt zu finden sind.
Wie lustvoll ein politisches Programm sein kann, zeigen am Abend darauf Pamela und Wolf Biermann im Gorki-Theater in Berlin mit dem Programm «Ach, die erste Liebe – paar Lieder als Seelenbrot in finsteren Zeiten». Wie nicht anders zu erwarten, präsentieren der Liedermacher und seine Frau einen Abend voller politischer Lieder – ausgehend von einer Adaption von «Shakespeare, Sonett 66» über Volks- oder Soldatenlieder, Liedern mit Texten von Heinrich Heine, Berthold Brecht, Yosef Papernikov, Georges Brassens und Biermann.
Es ist ein Antikriegsabend ohne falschen Pazifismus und mit Aufruf zur Solidarität mit Menschen in Israel und Palästina. Auch das findet sich so in Berlin – ohne Buhrufe oder Aufstand. In einer Stadt, die durch die neuen Ost–West-Konflikte gerade zermalmt wird und ein paar Tage wie die ganze Welt durch Trumps «Liberation Day» neu herausgefordert bzw. vor sich hergetrieben wird.
Alles schon mal dagewesen: die Strafzölle, die Massenentlassungen in US-Ministerien, Angriffe auf Wissenschaft, Medien, Justiz und so fort. Doch eben nicht in dieser Kumulation.
Karl Kraus nannte seine in der «Die Fackel» wiederkehrende Rubrik Aphorismensammlung schliesslich «Pro domo et mundo» (deutsch: «In eigener und weltweiter Sache»). Er haderte mit vielem seiner Zeit und schrieb: «Die Demokratie ist die Revolution gegen die Revolution.» Diese Revolution sieht er als ethisch motivierte, oft idealistisch getragene Umwälzung der Gesellschaftsverhältnisse. «Die Revolution gegen die Demokratie vollzieht sich im Selbstmord des Tyrannen.» Vielleicht mag er recht behalten – und die Kultur macht ihnen den Garaus –, wenn er schreibt: «Die Kultur endet, indem die Barbaren aus ihr ausbrechen.» Bücher sind eine Grundlage dafür.
Yves Kugelmann ist Chefredaktor der JM Jüdischen Medien AG.
das jüdische logbuch
04. Apr 2025
Die Revolution gegen die Demokratie
Yves Kugelmann