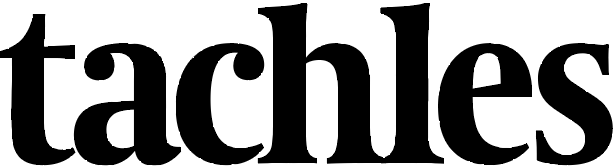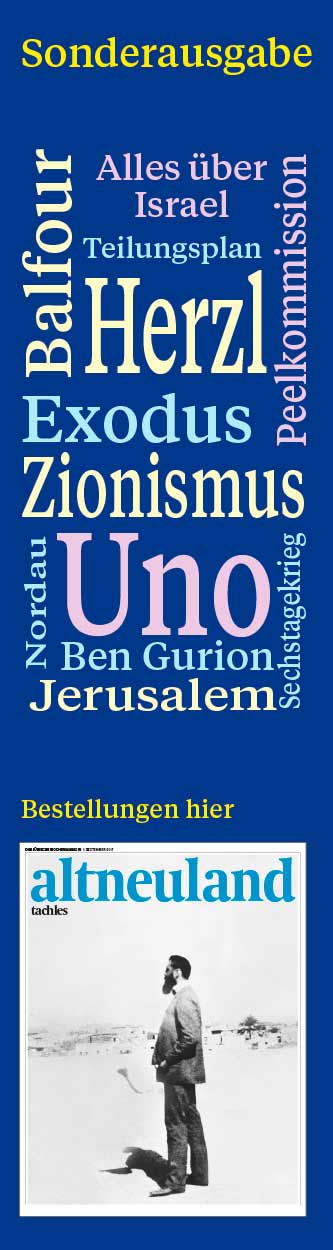Venedig, Mai 2024. Auf Hebräisch fragt die Frau Mitte Vierzig auf dem Vorplatz der Giardini von Venedig: «Wo ist der bolivianische Pavillon?». Er ist gar nicht so leicht zu finden. Es ist heiss, kein Schatten in der Nähe. Ein Student weist ihr den Weg. In diesen Tagen hat es viele israelische Besucher in Venedig, in Basel. Sie schauen sich Kunst an und sehen sich als Teil dieser Veranstaltungen. Die 60. Kunstbiennale in Venedig markiert schon mit dem Titel der von Adriano Pedrosa in den Arsenale kuratierten internationalen Kunstausstellung «Stranieri Ovunque – Fremde überall» eine thematische Brisanz, die sich in den ausgestellten Werken dann unaufgeregt in Kunst und Denkanstössen auflöst. Zum Glück. Venedigs Biennale zeigt, wie Kunst sehr wohl mit Konflikten und Kriegen in der Ukraine oder Nahost umgehen und einen Raum für Dialog und Positionierung schaffen kann. Während der im Nachgang zum Documenta-Skandal in Verruf geratene sogenannte globale Süden rundum als antisemitisch und antiisraelisch konnotiert wird, holen sich die Kulturen aus eben diesem Süden durch die Kunst den Blick auf eine Welt zurück, die im sogenannten Westen zu oft verborgen bleibt. Sowohl in den Arsenalen wie auch in den Länderpavillons der Giardini ist asiatische, afrikanische, südamerikanische Kunst im besten Sinne omnipräsent, runden die Narrative zur aufgeworfenen Thematik des «Fremden» auf. Ein Thema, das auch an der Art Basel nochmals seinen Fortgang fand mit sogenannter engagierter Kunst im etablierten Teil, wenn etwa Claire Fontaines Schriftinstallation «Foreigners Everywhere» die Besucherschaft empfängt – wie in Venedig. Kunst soll und kann offener Referenz- und Reflexionsraum sein, in dem auch brisante Themen abseits von der Empörungsbewirtschaftung so eingebracht werden können. Die Berlinale und die Documenta sind daran gescheitert. Der israelische Pavillon in Venedig bleibt geschlossen. Kein Boykott, kein Antisemitismus, kein Skandal: «Die Künstler und Kuratoren des israelischen Pavillons werden die Ausstellung eröffnen, wenn ein Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln erreicht ist» heisst auf einem grossen Plakat, das löst die Frage bei den Besuchern aus, ob Kunst eine Sprache und Form finden kann, um auf solche aktuellen Konflikte einzutreten. Die Biennale dauert noch bis November. Die Gruppe von Menschen vor dem Pavillon diskutiert weiter und estimiert die Antwort. Ein anderer fragt, ob es eigentlich einen russischen oder eine ukrainischen Pavillon gibt. Es beginnt eine spannende Diskussion über Kunst in Zeiten von Krieg, die Rückgabe von geraubter Kunst und so fort. Einen Tag später kündigt die Stiftung E. G. Bührle an, dass sie zu sechs Bildern mit den Erben in Gespräche zu Lösungen eintreten will, gefolgt von der Ankündigung des Kunsthauses Zürichs, dass ein Monet-Gemälde an die rechtmässigen Erben zurückgegeben werden soll. Wenige Tage vor der Publikation des Berichts der Kommission von Raphael Gross über die somit bereits im Vorfeld widerlegte Tauglichkeit der einst vorgelegten Bührle-Provenienz von Lukas Gloor versuchen kreative Kommunikationsspinndoktoren die Realität zu definieren und die Öffentlichkeit für ihre Perspektive zu kapern. Wenige Tage bis zur Publikation des Gross-Berichts mag das gelingen, doch kann das an der Realität nichts ändern: In den kommenden Monaten und Jahren wird das Thema Provenienz der Sammlung Bührle und der eigenen Bestände des Kunsthauses Zürich andauern. Das beginnt mit jenen Werken, die die Kommission als problematisch aufzeigen könnte, die über die sechs genanten Werke hinausgehen, und endet letztlich in den Bildern der Sammlungen der Bestände von Max Emden, der in beiden Ankündigungen nicht mal erwähnt ist. Es ist dieser Ankündigungsparkour auf Raten: zuerst Negierung, dann Kritik an Kritikern, dann Zwangsarbeiterentschädigungen der Stadt Zürich an Stelle der Familie Bührle, dann völlig unnötige voreilige Eingriffe in die bestehende Bührle-Hängung unter fragwürdiger Einbringung jüdischer Schicksale und nun die dosierten Eingeständnisse, die die Glaubwürdigkeit von Politik und Kunsthaus-Management in Zürich nochmals in Frage stellen. Und dann kommt der 7. Oktober, der neue Antisemitismus überholt den alten und viele fragen sich, was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte, wenn auch die Kontexte auf den ersten Blick ganz andere sind. Sind die verfestigten, alten Judenbilder, die Stereotype, die Reflexe auf Forderungen und der falsche Diskurs dann ebenso Brandbeschleuinger der Gegenwart wie jene, die durch den Krieg noch hinzukommen? Vermengt sich da das eine und das andere zu etwas gefährlich Neuem? Ein kleine Denkaufgabe an die hochbezahlten Kommunikationsabteilungen, PR-Büros und Anwaltskanzleien sowie an eine Stadtpolitik, in deren Mitte die Familie eines Nazi-Kollaborateurs hofiert wird, an deren Wänden in den Privathäusern viel Raubkunst hängt und deren Vermögen auf diese Zeit zurückgeht. Zürich tut der Kunst mit dem Tanz um die goldenen Kälber keinen Dienst und schafft mit Aktionismus kein Vertrauen. Eine respektvolle Diskussion, eine ganzheitliche Lösung drängt sich seit langem auf. Sonst wird das einmal mehr eine Dürrenmatt-Groteske.
das jüdische logbuch
21. Jun 2024
Bührle-Tango im Nahostgewitter
Yves Kugelmann