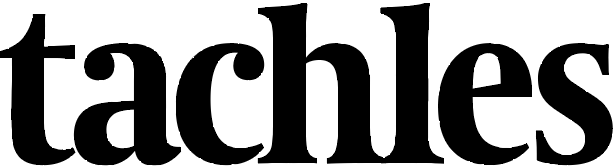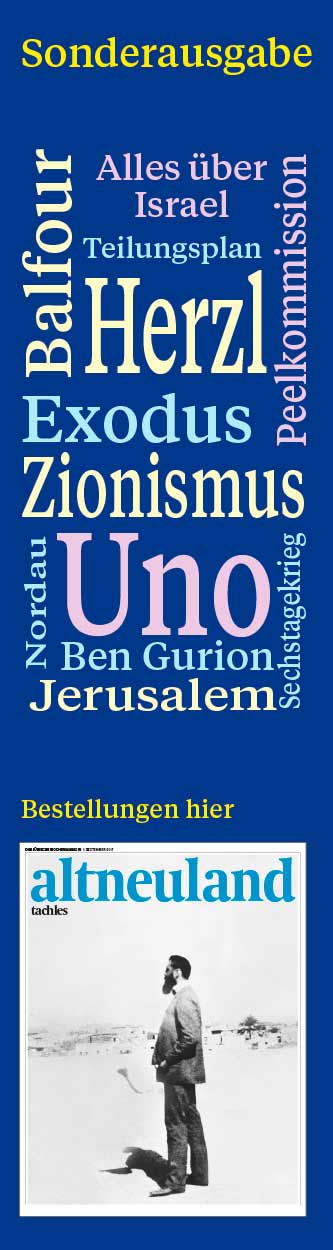Politische Indizes zeigen seit Jahren einen Rückgang in der Qualität demokratischer Systeme – vor diesem Hintergrund hat die Schweizer Botschaft in Israel das Democracy Dialogue Lab lanciert.
Die monatelangen Massenproteste gegen die Justizreform, die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung und die anhaltende sicherheitspolitische Ausnahmesituation haben eine Entwicklung sichtbar gemacht, die sich in Israel seit Jahren abzeichnete: die wachsende Auseinandersetzung um Qualität, Grenzen und Tragfähigkeit der Demokratie. Dabei geht es längst nicht mehr nur um juristische Verfahren oder institutionelle Balance, sondern um das grundsätzliche Gefühl politischer Teilhabe und Wirksamkeit.
Die Schweiz als Gesprächspartnerin
Dass sich die Schweiz mit diesen Fragen befasst, ist kein neues Anliegen, wurde aber lange mit Zurückhaltung verfolgt. «Demokratieförderung hatte lange einen schlechten Ruf», sagt der Schweizer Botschafter in Israel, Simon Geissbühler, dazu. Zu präsent seien die Erinnerungen an gescheiterte Demokratisierungsexporte gewesen. «Es entstand der Eindruck, man erkläre anderen, wie Demokratie zu funktionieren habe – genau das wollten wir vermeiden.» Mit den neuen Demokratie-Leitlinien des Eidgenössischen Departments für auswärtige Angelegenheiten hat die Schweiz ihren Ansatz neu definiert: weg von Vermittlung, hin zu Dialog und Partnerschaften. Demokratie soll nicht vermittelt, sondern gemeinsam reflektiert werden.
Israel sei für diesen Dialog kein zufälliger Ort. Aus Sicht des Botschafters ist es «eine Demokratie unter Stress»: mit klaren Anzeichen von Rückschritten, aber zugleich mit einer aussergewöhnlich aktiven Zivilgesellschaft. «Die Proteste gegen die Justizreform sind auch ein Zeichen demokratischer Lebendigkeit», sagt er. «Wenn Menschen nicht in einer Demokratie leben, können sie nicht in dieser Form demonstrieren.»
Ein Labor für Demokratie
Der Name Democracy Dialogue Lab ist bewusst gewählt. «Lab» steht für das Experimentieren mit offenen Ergebnissen und die Bereitschaft, Ansätze auch wieder zu verwerfen. «Manches funktioniert, manches nicht – beides gehört dazu», sagt Geissbühler. Zentral ist auch der Dialog auf Augenhöhe. Umgesetzt wurde dieser Ansatz zunächst in vier Fokusgruppen. Im Zentrum standen keine politischen Programme oder fertige Lösungen, sondern persönliche Erfahrungen: wie Demokratie im Alltag erlebt wird, wo sie an Wirksamkeit verliert und welche Rolle ein Austausch mit Schweizer Institutionen als gemeinsamer Reflexionsraum spielen könnte.
Lokale Demokratie statt grosse Ideologien
In der ersten Fokusgruppe diskutierten Forschende aus Universitäten und Thinktanks, die sich mit Demokratietheorie, institutioneller Stabilität und politischem Wandel befassen und die Entwicklungen in Israel international einordneten.
Einen anderen Blick brachte die zweite Fokusgruppe ein, in der sich junge Erwachsene aus NGOs, aktivistischen Zusammenhängen sowie religiösen und säkularen Milieus austauschten. Viele beschrieben ein deutliches Unbehagen gegenüber einem System, das Demokratie vor allem auf den Wahlakt reduziere. Parteien erschienen austauschbar, politische Entscheidungen fern vom Alltag. «Ist das wirklich Demokratie?», sei eine häufige Frage gewesen, so Geissbühler. Der Wunsch nach direkter Mitsprache, zumindest auf lokaler Ebene, sei entsprechend gross gewesen.
Besonders prägend war die dritte Fokusgruppe mit Vizebürgermeisterinnen und -bürgermeistern aus unterschiedlichen israelischen Städten. Jüdisch, arabisch, säkular und ultraorthodox. Im Zentrum standen konkrete Alltagsprobleme wie Wohnraum, Bildung, Sicherheit und Infrastruktur. Dabei zeigte sich, dass sich ähnliche Herausforderungen über gesellschaftliche Grenzen hinweg finden. Während in Ramat Gan Fragen der Gleichstellung und des Umgangs mit vielfältigen Familienformen im Vordergrund stehen, kämpfen Bnei Brak und Tira mit akuter Wohnungsnot, aus unterschiedlichen Gründen, aber mit vergleichbaren Folgen. «Plötzlich wurde sichtbar, dass ein arabischer Vizebürgermeister und ein ultraorthodoxer Vizebürgermeister mehr gemeinsame Probleme haben als gedacht», sagt Geissbühler. Dass diese Gespräche sonst kaum stattfinden, sei ein zentrales Problem.
Ein Moment blieb dem Botschafter besonders in Erinnerung: Der Vizebürgermeister aus Tira habe gesagt, die Einladung an den Tisch der Schweizer Residenz habe ihn tief bewegt. Er habe oft das Gefühl, bei Debatten über Demokratie in Israel keinen Platz zu haben. «Allein dafür hat sich dieses Projekt gelohnt.»
Die vierte Fokusgruppe aus dem Tech- und Start-up-Sektor rückte schliesslich Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und Vertrauen in den Vordergrund und beschrieb Demokratie zugleich als Voraussetzung für Innovation und als gefährdetes Gut, dessen Erosion langfristige Folgen haben könnte.
Inspiriert von der Schweiz
Über alle Gruppen hinweg zeigte sich eine Verschiebung der Perspektive: weg von abstrakten Debatten über Staatsform und Institutionen, hin zu sehr konkreten Fragen des Alltags. Demokratie wurde weniger als verfassungsrechtliches Konstrukt verstanden, sondern als etwas, das sich im unmittelbaren Lebensumfeld bewähren muss. In diesem Zusammenhang tauchte immer wieder der Vergleich zur Schweiz auf. Nicht als Modell, das sich übertragen liesse, sondern als Referenzpunkt für eine andere Art, Demokratie zu denken. Besonders direkte Mitsprache und kommunale Autonomie stiessen auf Interesse
Vom kleinen Kreis zur öffentlichen Debatte
Nach den Fokusgruppen wurde das Democracy Dialogue Lab vergangene Woche in Tel Aviv erstmals einem breiteren Publikum vorgestellt. An einer Konferenz diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, wie sich demokratischer Rückbau in Israel und international vollzieht und was Demokratien widerstandsfähiger machen kann.
Der Ökonom und frühere Regierungsberater Eugene Kandel beschrieb die Lage Israels mit einem eindrücklichen Bild: «Wir haben eine wunderbare Familie, aber wir leben in einem kaputten Haus. Irgendwann wird das Haus einstürzen und dann verschwindet auch die Familie. Wir müssen ein besseres Haus bauen.» Das Problem liege weniger im gesellschaftlichen Engagement als in institutionellen Strukturen, die Verantwortung und Stabilität nicht ausreichend trügen.
Noch kritischer fiel die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uriel Abulof aus, der infrage stellte, ob Israel derzeit überhaupt noch als Demokratie gelten könne. Demokratie erschöpfe sich nicht in Wahlen allein, sondern brauche wirksame Gewaltenteilung, Gleichheit vor dem Gesetz und den Schutz von Minderheiten. All dies sei in Israel zunehmend unter Druck.
Einen praxisnahen Blick brachte Kati Piasecki, stellvertretende Bürgermeisterin von Bat Yam, ein. Demokratie entscheide sich im Alltag, bei Wohnraum, Bildung und Sicherheit und sozialer Infrastruktur. Gemeinden trügen dabei grosse Verantwortung, verfügten aber über zu wenig Kompetenzen. «Wenn lokale Politik Erwartungen nicht erfüllen kann, verliert Demokratie ihre Glaubwürdigkeit», sagte Piasecki.
Auch Sameh Iraqi, stellvertretender Bürgermeister der arabischen Stadt Tira, beschrieb Demokratie als formales Versprechen, das ohne Sicherheit, Gleichbehandlung und staatliche Präsenz im Alltag kaum erfahrbar werde.
Zwischen Erosion und Widerstand
Viele Beiträge teilten die Einschätzung, dass demokratischer Rückbau meist schleichend erfolgt: durch Vertrauensverlust, wachsende Distanz zwischen Politik und Bevölkerung und die Konzentration von Macht. Formale Institutionen allein, so der Tenor, reichen nicht aus, um Demokratie zu tragen. Entscheidend seien Vertrauen, Gleichbehandlung und die Erfahrung, gehört zu werden.
Trotz der ernüchternden Diagnosen wurde auch die aussergewöhnliche Stärke der israelischen Zivilgesellschaft hervorgehoben. Protestbewegungen, freiwillige Netzwerke und lokale Initiativen übernehmen Verantwortung, wo staatliche Strukturen an ihre Grenzen stossen. Diese Mobilisierung gilt als demokratische Ressource, zugleich aber auch als Hinweis auf die Fragilität institutioneller Grundlagen.
Demokratie als Praxis, nicht als Zustand
Die Konferenz bot damit wenig Hoffnung auf schnelle Lösungen, machte jedoch deutlich, wo demokratisches Potenzial weiterhin vorhanden ist. Entsprechend standen am Ende keine Schlussfolgerungen, sondern ein Arbeitsauftrag im Raum: Das Democracy Dialogue Lab soll vom Austausch zur Praxis übergehen, mit bewusst kleinen Schritten wie Dialogformaten für kommunale Akteure, punktuellen Kooperationen mit Schweizer Institutionen oder Mediationsprojekten in gemischten Städten. «Vielleicht funktioniert nicht alles», sagt Geissbühler. «Aber wenn zwei oder drei Ansätze weiterverfolgt werden können, ist viel gewonnen.» Demokratie wird dabei nicht als exportierbares Modell verstanden, sondern als fortlaufende Praxis, die immer wieder neu ausgehandelt werden muss.