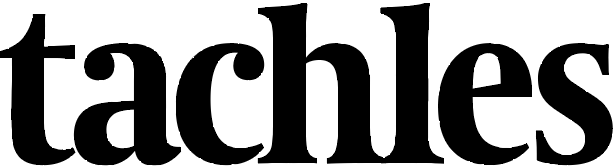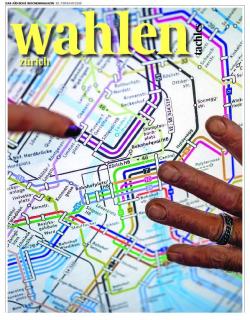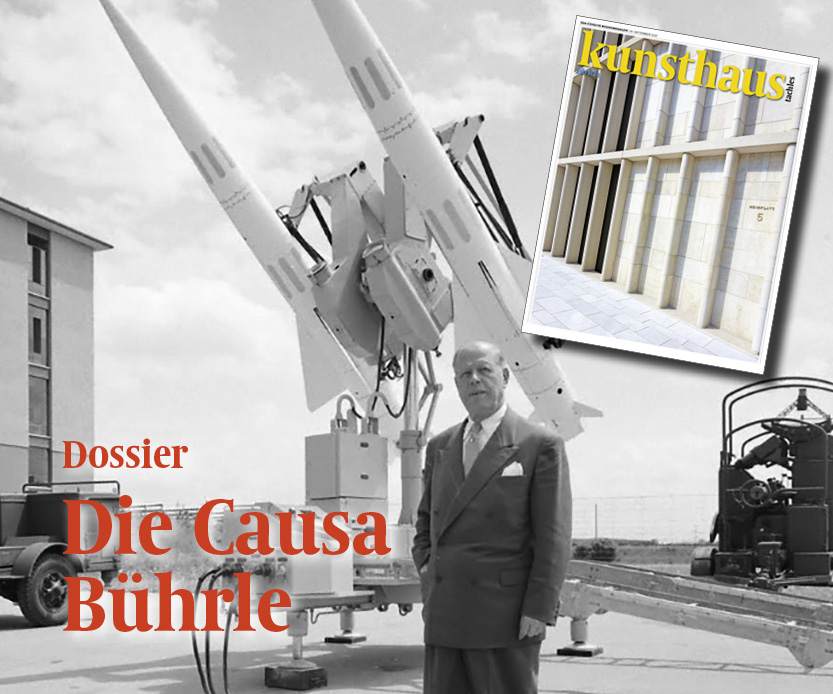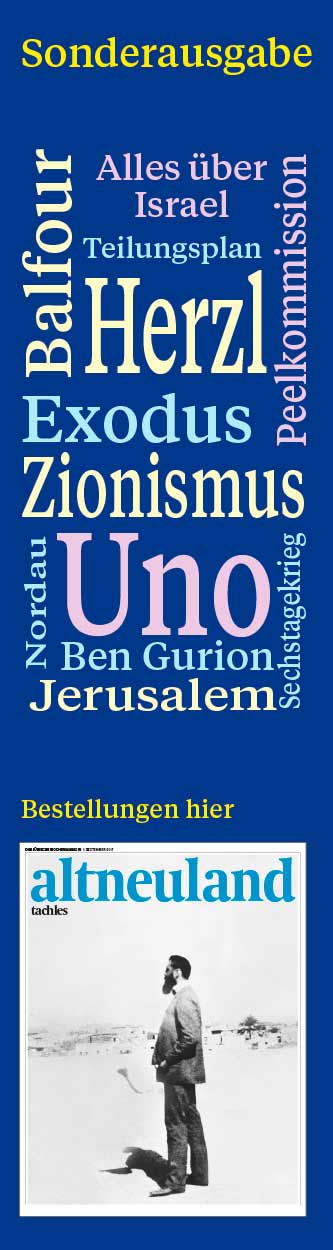12:12 - 12.Mär 2026
Der Bezug dieses Dienstes ist kostenpflichtig.
Sie können diesen Dienst direkt ohne Anmeldung und einmalig via dem Zahlungssystem Datatrans beziehen.
Als Alternative können Sie auch ein tachles-Konto eröffnen. Ein tachles Konto bietet Ihnen viele Vorteile. Das Eröffnen des Kontos ist gratis und schnell gemacht. Sie benötigen dafür eine E-mail Adresse.